verschlossene Eileiter und alternative Heilmittel/Methoden
-
Dr.Robert Kovarik
- Rang0
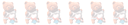
- Beiträge: 30
- Registriert: 19 Sep 2010 19:49
Moortamponaden korrekt zu machen
Nein, so wird es nicht wirken.
Nicht von Ungefähr empfehle ich immer ZUERST mein Fachbuch"Vaginale Moorbehandlung" darüber zu lesen! (www.biotherik.com und dann können Sie sich durchklicken).
Wenn man es nicht richtig macht, so würde es höchstwahrscheinlich nur verschwendetes Geld und Zykluszeit - und eine schlechte Erfolgsreferenz bedeuten.
Es ist nicht immer möglich alle Anwendungsfehler ausführlich zu erklären, die in dem Buch sehr genau mit wissenschaftlichen, leicht verständlichen Hintergründen beschrieben sind.
Jetzt also nur dies, was in der Kürze vielleicht etwas schwieriger zu verstehen sein mag:
Die Wärmeempfindlichkeiten der Haut und der Scheide sind anders. Die Scheide hat keine Wärmerezeptoren, im Gegensatz zu der Haut. Daher spürten Sie Ihre Unterleibspackung intensiver als Ihr Moortampon in der Scheide.
Jede äußere Wärmeanwendung verpufft nocht bevor sie das innere Genitale erreicht. Einerseits wird die äußere Wärmeenergie an die Erwärmung der dicken Haut-Fett-Muskel-Schicht verbraucht, das durch das kühlere Blut ständig angekühlt wird. Andererseits sorgt die uns angeborene Wärmegegenregulation für wirksame Abwehrmaßnahmen (Schwitzen .a.) um die Erhöhung der Temperatur im Körperkern möglichst zu verhindern.
Der Trick der vaginalen Wärmeanwendung liegt darin, die Wärmegegenregulation umzugehen und die Wärmeenergie ohne größeren Verlusten direkt dort zu bringen, wo sie wirken soll, ohne den übrigen Organismus zu belasten, was die allgemeine Gegenregulation provozieren würde.
Wäre es kein Moor, sonder das Wasser ,so würden Sie sich ab 44 Grad Celsius schon verbrühen. Bei dem zähflüssigen Moor dagegen ist selbst die Temperatur 46 Grad Celsius noch relativ niedrig. Am Moortamponrand (Moorpackungsrand), abgekühlt durch die Scheide (Haut), pendelt sich nämlich nur eine sehr schonende Temperatur, die bei 46 Grad Moortampontemperatur in Wirklichkeit an der Scheide kaum 40 Grad erreicht.
Die Wärmeenergie strömt dann langsam aus dem Wärmedepot des heißen Moortampons- (Moorpackungs)-Kerns aus. Die Moortemperatur von 50 - 52 Grad Celsius schadet deshalb sowohl der Haut als auch der Scheide nicht.
Erst diese MOOR(!)-Temperatur hat so viel Energie um aus dem Tamponkern die Wärme für 2 Stunden schonend und wirksam freizugeben.
Eine nur kurzfristige Wärmeanhebung im kleinen Becken, wie bei Moortamponade-Temperatur von nur 46 Grad Celsius, deren Energiedepot bald erlischt, hat nämlich nur einen geringen Impuls um den lokalen Stoffwechsel mit der Steigerung der Produktion der intratubaren Endolymphe zu bewirken und die Wärmeenergie würde bereits in der kühleren Scheide, und dann unterwegs zu der Tube in der aufsteigenden Arteria Uterina an andere Organe (Gebärmutter) veitergegeben und verbraucht, bis sie den Eileiter erreicht.
Also lesen Sie lieber zuerst mein Buch, wo sie einfache Tabellen mit allen Angaben der korrekter Applikatikon zu jeder Indikation finden.
Zu Hause:
Erwärmen Sie die Tube am besten in dem auf 50 Grad Celsius thermostatisch eingestellten Backofen binnen etwa 30 minuten.
Oder machen Sie es schneller in einem heißen Wasserbad: Schätzen Sie die Zeit zuerst, dann aber messen Sie die Temperatur direkt in der Vagipeat-Tube, noch vor der Anwendung! Ist die erwünschte Temperatur noch nicht erreicht, so legen Sie die Tube erneut in das Wasserbad. Ist sie überschritten, warten Sie eine Weile beider Zimmertemperatur und kontrollieren sie erneut.
Ich werde eine Kapitel aus meinem Buch zu der Moorbehandlung bei Eileiterproblemen in dem nächsten Beitrag veröffentlichen.
Nicht von Ungefähr empfehle ich immer ZUERST mein Fachbuch"Vaginale Moorbehandlung" darüber zu lesen! (www.biotherik.com und dann können Sie sich durchklicken).
Wenn man es nicht richtig macht, so würde es höchstwahrscheinlich nur verschwendetes Geld und Zykluszeit - und eine schlechte Erfolgsreferenz bedeuten.
Es ist nicht immer möglich alle Anwendungsfehler ausführlich zu erklären, die in dem Buch sehr genau mit wissenschaftlichen, leicht verständlichen Hintergründen beschrieben sind.
Jetzt also nur dies, was in der Kürze vielleicht etwas schwieriger zu verstehen sein mag:
Die Wärmeempfindlichkeiten der Haut und der Scheide sind anders. Die Scheide hat keine Wärmerezeptoren, im Gegensatz zu der Haut. Daher spürten Sie Ihre Unterleibspackung intensiver als Ihr Moortampon in der Scheide.
Jede äußere Wärmeanwendung verpufft nocht bevor sie das innere Genitale erreicht. Einerseits wird die äußere Wärmeenergie an die Erwärmung der dicken Haut-Fett-Muskel-Schicht verbraucht, das durch das kühlere Blut ständig angekühlt wird. Andererseits sorgt die uns angeborene Wärmegegenregulation für wirksame Abwehrmaßnahmen (Schwitzen .a.) um die Erhöhung der Temperatur im Körperkern möglichst zu verhindern.
Der Trick der vaginalen Wärmeanwendung liegt darin, die Wärmegegenregulation umzugehen und die Wärmeenergie ohne größeren Verlusten direkt dort zu bringen, wo sie wirken soll, ohne den übrigen Organismus zu belasten, was die allgemeine Gegenregulation provozieren würde.
Wäre es kein Moor, sonder das Wasser ,so würden Sie sich ab 44 Grad Celsius schon verbrühen. Bei dem zähflüssigen Moor dagegen ist selbst die Temperatur 46 Grad Celsius noch relativ niedrig. Am Moortamponrand (Moorpackungsrand), abgekühlt durch die Scheide (Haut), pendelt sich nämlich nur eine sehr schonende Temperatur, die bei 46 Grad Moortampontemperatur in Wirklichkeit an der Scheide kaum 40 Grad erreicht.
Die Wärmeenergie strömt dann langsam aus dem Wärmedepot des heißen Moortampons- (Moorpackungs)-Kerns aus. Die Moortemperatur von 50 - 52 Grad Celsius schadet deshalb sowohl der Haut als auch der Scheide nicht.
Erst diese MOOR(!)-Temperatur hat so viel Energie um aus dem Tamponkern die Wärme für 2 Stunden schonend und wirksam freizugeben.
Eine nur kurzfristige Wärmeanhebung im kleinen Becken, wie bei Moortamponade-Temperatur von nur 46 Grad Celsius, deren Energiedepot bald erlischt, hat nämlich nur einen geringen Impuls um den lokalen Stoffwechsel mit der Steigerung der Produktion der intratubaren Endolymphe zu bewirken und die Wärmeenergie würde bereits in der kühleren Scheide, und dann unterwegs zu der Tube in der aufsteigenden Arteria Uterina an andere Organe (Gebärmutter) veitergegeben und verbraucht, bis sie den Eileiter erreicht.
Also lesen Sie lieber zuerst mein Buch, wo sie einfache Tabellen mit allen Angaben der korrekter Applikatikon zu jeder Indikation finden.
Zu Hause:
Erwärmen Sie die Tube am besten in dem auf 50 Grad Celsius thermostatisch eingestellten Backofen binnen etwa 30 minuten.
Oder machen Sie es schneller in einem heißen Wasserbad: Schätzen Sie die Zeit zuerst, dann aber messen Sie die Temperatur direkt in der Vagipeat-Tube, noch vor der Anwendung! Ist die erwünschte Temperatur noch nicht erreicht, so legen Sie die Tube erneut in das Wasserbad. Ist sie überschritten, warten Sie eine Weile beider Zimmertemperatur und kontrollieren sie erneut.
Ich werde eine Kapitel aus meinem Buch zu der Moorbehandlung bei Eileiterproblemen in dem nächsten Beitrag veröffentlichen.
-
Dr.Robert Kovarik
- Rang0
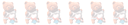
- Beiträge: 30
- Registriert: 19 Sep 2010 19:49
Eileiter-Probleme bei Kinderwunsch
Aus meinem Buch "Vaginale Moorbehandlung" - www.biotherik.com
Eileiter-Ursache der Sterilität und ihre Behandlung mit der vaginalen Moortamponade
Nun höre ich förmlich das Jubeln einiger meinen schulmedizinischen Fachkollegen: „Es ist doch purer Unsinn, was der Mann von sich gibt! Denkt logisch! Wie kann eine schmutzige Moorbehandlung in der Vagina die Verwachsungen im Innern der weit entfernten Eileiter beseitigen, mit denen sie überhaupt keinen Kontakt hat. Wir selbst müssen sie so mühsam, so lange und so kompliziert operieren! Jetzt haben wir den Autor endlich als einen Scharlatan entpuppt!“
So ähnlich, mit der vermeintlichen Logik auf Grund seines eigenen Unwissens, argumentierte ihrer Zeit auch die Französische Akademie der Wissenschaft, als sie erstmalig die Erfahrungsberichte der Bauern über die auf ihren Feldern gefundenen Meteoriten beurteilen sollte. Sie hat damals folgende „wissenschaftliche“ Stellungnahme in diesem Sinne herausgegeben: „Es ist ein Unsinn. Die Bauern spinnen. Sie machen sich nur wichtig. Man darf Ihnen keinen Glauben schenken. Es ist nämlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass Gegenstände schwerer als Luft sich in der Luft nicht halten können. Folglich können keine Steine aus dem Himmel fallen.“
Heute wissen wir, wer Recht hatte. Trotz aller isolierten wissenschaftlichen Erkenntnisse dürfen wir den ganzheitlichen Blick nicht unterschätzen.
Es ist viel intelligenter die Naturvorgänge, die wir noch nicht voll verstehen, als eine Art Blackbox zu behandeln. Das gilt allgemein: Die Erfahrenen exakt nachahmen. Einfach vorne den empfohlenen Impuls einstecken. Hinten fällt dann die erwünschte Wirkung aus.
Bei der vaginalen Moorbehandlung sind wir glücklicherweise in einer besseren Position als bei einer Blackbox. Hier sind wir in der Lage die Hintergründe zu verstehen:
Wir wissen bereits, dass sowohl die Spermien als auch das befruchtete Ei in einer Flüssigkeit im Eileiter schwimmen müssen. Das ist klar.
Woher kommt diese Flüssigkeit?
Es ist die so genannte Endolymphe. Sie wird durch die zahlreichen sekretorischen Zellen direkt im Eileiter produziert.
Die kleinen Spermien haben alle ihren eigenen Motor und ihren eigenen Fortbewegungsschwanz. Sie können aktiv schwimmen. Das ungleich größere und schwerere Ei hat aber nichts dergleichen.
Wie kommt das schwere, unbewegliche Ei in die Gebärmutter?
Es wird passiv mit Hilfe von zweierlei Bewegungen im Eileiter transportiert:
Zuerst sind es die kleinen Haarzellen, die mit ihren Flimmern das Ei sanft in Richtung Gebärmutter tragen. Es funktioniert ähnlich wie bei den Staubkörnchen in den Bronchien, in denen sie mit dem Schleim des mikroskopischen Flimmerepithel-Teppichs nach oben zum Abhusten gebracht werden.
Für den Transport des schweren Eis reicht dies aber noch nicht ganz. Hier kommt noch der Schub von der Bewegung der glatten Muskulatur der Eileiterwand hinzu. Es ist eine ähnliche Peristaltik wie im Darm. Und was die kann, das ist hoffentlich jedem bekannt.
Der Eileiter ist auf beiden Seiten offen. Durch psychische oder schmerzhafte Einflüsse, kann sich seine glatte Muskulatur so verkrampfen, dass nicht einmal Spermien durchkommen. Unter den normalen Bedingungen fließt die Endolymphe ungehindert ab.
Die Flüssigkeit auf beiden Eileiter-Enden fließt aus. Was nun?
Die Flüssigkeit muss andauernd und in großen Mengen nachproduziert werden. Eine sekretorische Zelle kann nur eine kleine Menge Endolymphe freisetzen. Daher ist eine Unmenge an sekretorischen Zellen nötig. Sie passen nicht alle in die Eileiterwand, denn dort müssen noch die Haarzellen des Flimmerepithels Platz finden.
Die nötige Menge der sekretorischen und Haarzellen passt nicht an die Eileiterwand. Was nun?
Die Natur ist intelligent. Der Eileiter hat seine Schleimhaut einfach vergrößert. Sie ist jetzt so groß, dass sie sich in vielen feinen Falten in das Innere des Eileiters vorwölbt. Erst jetzt bietet sie genügend Platz den sekretorischen Zellen für die ausreichende Produktion der Flüssigkeit und auch den Haarzellen für den Eitransport. Diese inneren Falten sind sehr fein und sehr zahlreich. Sie liegen dicht aufeinander.
Dies hat jedoch einen Nachteil: Die kleinste Entzündung oder Verletzung des Eileiters führt leicht zu einer Verklebung (Verwachsung) der Schleimhautfalten. Die Verwachsungen der dichten, inneren Schleimhautfalten können so zahlreich werden, dass sie den Transportweg in beiden Richtungen sperren. Dann kommt keine Spermie durch, und wenn doch, kann wiederum das viel größere, befruchtete Ei die Gebärmutter nicht mehr erreichen. Es droht die lebensgefährliche Eileiterschwangerschaft.
In den Unikliniken werden diese Verbindungen der kleinsten Falten im Innern des Eileiters fein mikrochirurgisch in stundenlangen, sprich teueren Operationen voneinander getrennt. Das allerdings bedeutet eine weitere Verletzung der Eileiter, egal, wie schonend auch operiert wird. Bei jeder Verletzung entsteht eine kleine Blutung, die mit Blutgerinnsel gestoppt werden muss. Bei jeder Elektro- oder Laserkoagulation entsteht ein kleiner, fester Schorf, der aufgeweicht und abgebaut werden muss. Sonst entsteht eine einengende Vernarbung. Gleichgültig der Operationsmethode entsteht immer die Gefahr der Fibrinfreisetzung, die zu erneuten Eileiter-Verwachsungen führen kann. Dieser Abbauprozess läuft im Prinzip immer wie eine kleine Entzündung, nur ohne Bakterien, ab.
Beim Kinderwunsch haben wir es oft mit folgenden Problemen im Bereich der Eileiter zu tun:
1. Ungünstige lokale neurovegetative Lage
2. Viel zu trockene Eileiter
3. Verkrampfungen der Eileitermuskulatur
4. Störungen der Eileiterperistaltik
5. Innere Verwachsungen im Eileiter
Bei all diesen Problemen kann die preiswerte, angenehme und ungefährliche vaginale Moorbehandlung besser, schneller und nachhaltiger helfen, als jede teure, schmerzhafte und gefährliche mikrochirurgische Operation.
Lösung für Problem Nr. 1
Wird der heiße Moortampon richtig bis in das hintere Scheidengewölbe platziert (hier werden manchmal Fehler gemacht!), so erwärmt er die in unmittelbarer Nähe liegenden neurovegetativen Frankenhäuserschen Ganglien. Sie werden dann für eine bessere neurovegetative Lage und Mikrozirkulation sorgen.
Lösung für Problem Nr. 2
Die heiße vaginale Moortamponade erwärmt auch die Arteria Uterina, die nur wenige Millimeter hinter dem hinteren Scheidengewölbe verläuft. Ihr warmes Blut wird nach oben entlang der Gebärmutter und der Eileiter bis zu den Eierstöcken transportiert. Unterwegs erreicht die Wärme tiefgründig alle Schichten dieser Organe.
Wir wissen bereits, dass die Erwärmung sowohl die Durchblutung als auch die Sekretion steigert. Auf diese Weise werden die sekretorischen Zellen zu einer Überproduktion der Endolymphe angeregt.
Lösung für Problem Nr. 3 und 4
Das warme Blut und die trophotrope Umstellung der Frankenhäuserschen Ganglien entkrampft auch die Spasmen der glatten Muskulatur und steigert ihre normale Peristaltik. Das wurde mehrmals mit in Vitro Versuchen nachgewiesen.
Bleibt nur noch der Höhepunkt der vaginalen Moorbehandlung zu erklären:
Lösung für Problem Nr. 5
Wie werden die Eileiter-Verwachsungen ohne jede Operation beseitigt?
Zuerst müssen wir uns erneut klar machen, dass die Verwachsungen im Eileiter eigentlich nur Fibrinverklebungen sind. Unter ihnen bleiben die zahlreichen gesunden sekretorischen Zellen eingeschlossen. Sie sind nur mit dem Fibrin-Klebstoff bedeckt. Sie sind nicht krank und nicht tot. Sie werden weiter mit Nährstoffen und Sauerstoff aus dem Blut versorgt und funktionieren daher weiter. Wir können sie mit einem richtig platzierten(!) heißen vaginalen Moortampon zur Überproduktion der Flüssigkeit anregen, und das sogar auf Distanz, wie wir das schon kennen, mit dem warmen Blut der Arteria Uterina über ihr Ramus tubarius.
Während der Moortamponade-Kur kann ein erfahrener Frauenarzt den Erfolg kontrollieren: Die feuchteren und daher dickeren Eileiter lassen sich oft als schmerzfreie(!), weiche Stränge ertasten. Das plötzliche Verschwinden dieses Tastbefunds spricht für die wieder erreichte Eileiterdurchgängigkeit. Mit der Ultraschalluntersuchung kann man es noch besser sehen. Es ist sinnvoll die gute Eileiterdurchgängigkeit durch eine entsprechende Untersuchung zu verifizieren, bevor ein Schwangerschaftsversuch vorgenommen wird.
Fibrin ist ein Klebstoff. In der Gebrauchsanleitung der meisten Klebstoffe steht, dass die zu verklebenden Stellen trocken sein müssen, damit der Klebstoff an ihnen haften kann. Jetzt können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn inmitten des Klebstoffs plötzlich viel Flüssigkeit erscheint, und sogar diffus.
Die Haftung eines jeden Klebstoffes wie Fibrin lässt mit der Befeuchtung schnell nach. Die Verwachsungen in den Eileitern lösen sich spontan und unblutig voneinander auf, ohne dass eine Verletzung entsteht und ohne dass eine neue Verwachsungsgefahr oder Vernarbung droht. Das frei gewordene Fibrin wird resorbiert.
Die durch Wärme ebenfalls angeregten peristaltischen Bewegungen der glatten Muskulatur der Eileiter helfen zusätzlich die zuvor verklebten Stellen voneinander zu trennen.
Ich kenne aus meiner Praxis noch zwei einfache Tricks für die Ärzte, um diesem sanften Trennungsprozess nachzuhelfen:
1. Die verdickten Eileiter lassen sich einzeln ertasten. Diese können mit beiden Händen einzeln vorsichtig massiert werden. Mit einer Hand in der Scheide und der anderen oben auf dem Bauch wird der Druck in den Eileitern sanft erhöht. Die aufgeweichten Verklebungen halten dem nicht Stand und lösen sich.
2. Es gibt handliche flache Vibrationsgeräte zu kaufen, die normalerweise zur Rückenbehandlung genutzt werden. In ihrer Gebrauchsanweisung wird oft davor gewarnt, das Gerät auf den Bauch zu setzen. Wenn Sie es auf den Unterleib setzen, droht überhaupt keine Gefahr. Wichtig ist: Die Harnblase musste immer voll sein. Die volle Harnblase wird bekanntlich zur Ultraschall-Untersuchung benötigt, weil die Flüssigkeit die mechanischen Ultraschallwellen bis an die Eileiter und darüber hinaus überträgt. Dasselbe Prinzip lässt sich auch bei der Unterbauch-Vibrations-Therapie nutzen, da es auch hier sich um mechanische Schwingungen handelt, die im Wasser gut weitergeleitet werden.
Die Vibrationen setzen kleinste Wasserquanten in Schwingung, die in den Eileiterverwachsungen noch eingeschlossenen sind. Die Flüssigkeit hat ein etwas anderes spezifische Gewicht als das festere Muskel- und Schleimhautgewebe. Daher kommt es zur unterschiedlichen Interferenz der Schwingung in all diesen Bereichen. Das Wasser wirkt hier wie eine Art des inneren Bollus, der hin und her gegen die Verklebung geworfen wird, bis diese nachgibt.
Mit der Lösung des letzten Problems steht der Schwangerschaft buchstäblich nichts mehr im Wege. Ich hoffe, der Sachverhalt ist Ihnen logisch und verständlich geworden?
Dazu wird eine längere Serie von heißen Moortamponaden angewandt. Je nach Schwere der Verwachsungen erstreckt sich die Behandlung manchmal über mehrere Zyklen nacheinander. Diese wärme-mechanische Therapie dürfen Sie unabhängig vom Zyklustag anwenden, mit Ausnahme der Periode, wo sie kontraindiziert ist (Endometriosegefahr!).
Nach Möglichkeit soll die vaginale Wärmebehandlung immer anschließend mit der transabdominalen Vibrationstherapie kombiniert werden.
Zusätzliche Möglichkeiten für Zuhause
Die Wechselwirkung des Halb- und Vollbades hat therapeutische Auswirkungen durch die Einpendelung der gesunden Vasomotorik: Der hydrostatische Druck-Unterdruckwechsel macht sich bis auf das subzelluläre Niveau bemerkbar. Er begünstigt Transportmechanismen an allen Membranen. Dies wirkt organerholend. Die Versorgung einzelner Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen, sowie ihre Entschlackung werden durch den Druck-/Unterdruckwechsel optimiert.
Ein Perlbad (Luftsprudelbad) bewirkt eine Mikromassagewirkung nachweislich noch in der Bauchhöhle. Das steigert die innere Lymphperistaltik, führt zur Entspannung, Muskeldetonisierung, Rezeptorenstimulation, Fazilitätswirkung, sexuelle Stimulierung, allgemeiner Anregung und neurovegetativer Umstimmung. Jedes warme Bad bewirkt eine reflektorische Spasmolyse der glatten Muskulatur bei Eileiter-Verkrampfungen.
Eileiter-Ursache der Sterilität und ihre Behandlung mit der vaginalen Moortamponade
Nun höre ich förmlich das Jubeln einiger meinen schulmedizinischen Fachkollegen: „Es ist doch purer Unsinn, was der Mann von sich gibt! Denkt logisch! Wie kann eine schmutzige Moorbehandlung in der Vagina die Verwachsungen im Innern der weit entfernten Eileiter beseitigen, mit denen sie überhaupt keinen Kontakt hat. Wir selbst müssen sie so mühsam, so lange und so kompliziert operieren! Jetzt haben wir den Autor endlich als einen Scharlatan entpuppt!“
So ähnlich, mit der vermeintlichen Logik auf Grund seines eigenen Unwissens, argumentierte ihrer Zeit auch die Französische Akademie der Wissenschaft, als sie erstmalig die Erfahrungsberichte der Bauern über die auf ihren Feldern gefundenen Meteoriten beurteilen sollte. Sie hat damals folgende „wissenschaftliche“ Stellungnahme in diesem Sinne herausgegeben: „Es ist ein Unsinn. Die Bauern spinnen. Sie machen sich nur wichtig. Man darf Ihnen keinen Glauben schenken. Es ist nämlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass Gegenstände schwerer als Luft sich in der Luft nicht halten können. Folglich können keine Steine aus dem Himmel fallen.“
Heute wissen wir, wer Recht hatte. Trotz aller isolierten wissenschaftlichen Erkenntnisse dürfen wir den ganzheitlichen Blick nicht unterschätzen.
Es ist viel intelligenter die Naturvorgänge, die wir noch nicht voll verstehen, als eine Art Blackbox zu behandeln. Das gilt allgemein: Die Erfahrenen exakt nachahmen. Einfach vorne den empfohlenen Impuls einstecken. Hinten fällt dann die erwünschte Wirkung aus.
Bei der vaginalen Moorbehandlung sind wir glücklicherweise in einer besseren Position als bei einer Blackbox. Hier sind wir in der Lage die Hintergründe zu verstehen:
Wir wissen bereits, dass sowohl die Spermien als auch das befruchtete Ei in einer Flüssigkeit im Eileiter schwimmen müssen. Das ist klar.
Woher kommt diese Flüssigkeit?
Es ist die so genannte Endolymphe. Sie wird durch die zahlreichen sekretorischen Zellen direkt im Eileiter produziert.
Die kleinen Spermien haben alle ihren eigenen Motor und ihren eigenen Fortbewegungsschwanz. Sie können aktiv schwimmen. Das ungleich größere und schwerere Ei hat aber nichts dergleichen.
Wie kommt das schwere, unbewegliche Ei in die Gebärmutter?
Es wird passiv mit Hilfe von zweierlei Bewegungen im Eileiter transportiert:
Zuerst sind es die kleinen Haarzellen, die mit ihren Flimmern das Ei sanft in Richtung Gebärmutter tragen. Es funktioniert ähnlich wie bei den Staubkörnchen in den Bronchien, in denen sie mit dem Schleim des mikroskopischen Flimmerepithel-Teppichs nach oben zum Abhusten gebracht werden.
Für den Transport des schweren Eis reicht dies aber noch nicht ganz. Hier kommt noch der Schub von der Bewegung der glatten Muskulatur der Eileiterwand hinzu. Es ist eine ähnliche Peristaltik wie im Darm. Und was die kann, das ist hoffentlich jedem bekannt.
Der Eileiter ist auf beiden Seiten offen. Durch psychische oder schmerzhafte Einflüsse, kann sich seine glatte Muskulatur so verkrampfen, dass nicht einmal Spermien durchkommen. Unter den normalen Bedingungen fließt die Endolymphe ungehindert ab.
Die Flüssigkeit auf beiden Eileiter-Enden fließt aus. Was nun?
Die Flüssigkeit muss andauernd und in großen Mengen nachproduziert werden. Eine sekretorische Zelle kann nur eine kleine Menge Endolymphe freisetzen. Daher ist eine Unmenge an sekretorischen Zellen nötig. Sie passen nicht alle in die Eileiterwand, denn dort müssen noch die Haarzellen des Flimmerepithels Platz finden.
Die nötige Menge der sekretorischen und Haarzellen passt nicht an die Eileiterwand. Was nun?
Die Natur ist intelligent. Der Eileiter hat seine Schleimhaut einfach vergrößert. Sie ist jetzt so groß, dass sie sich in vielen feinen Falten in das Innere des Eileiters vorwölbt. Erst jetzt bietet sie genügend Platz den sekretorischen Zellen für die ausreichende Produktion der Flüssigkeit und auch den Haarzellen für den Eitransport. Diese inneren Falten sind sehr fein und sehr zahlreich. Sie liegen dicht aufeinander.
Dies hat jedoch einen Nachteil: Die kleinste Entzündung oder Verletzung des Eileiters führt leicht zu einer Verklebung (Verwachsung) der Schleimhautfalten. Die Verwachsungen der dichten, inneren Schleimhautfalten können so zahlreich werden, dass sie den Transportweg in beiden Richtungen sperren. Dann kommt keine Spermie durch, und wenn doch, kann wiederum das viel größere, befruchtete Ei die Gebärmutter nicht mehr erreichen. Es droht die lebensgefährliche Eileiterschwangerschaft.
In den Unikliniken werden diese Verbindungen der kleinsten Falten im Innern des Eileiters fein mikrochirurgisch in stundenlangen, sprich teueren Operationen voneinander getrennt. Das allerdings bedeutet eine weitere Verletzung der Eileiter, egal, wie schonend auch operiert wird. Bei jeder Verletzung entsteht eine kleine Blutung, die mit Blutgerinnsel gestoppt werden muss. Bei jeder Elektro- oder Laserkoagulation entsteht ein kleiner, fester Schorf, der aufgeweicht und abgebaut werden muss. Sonst entsteht eine einengende Vernarbung. Gleichgültig der Operationsmethode entsteht immer die Gefahr der Fibrinfreisetzung, die zu erneuten Eileiter-Verwachsungen führen kann. Dieser Abbauprozess läuft im Prinzip immer wie eine kleine Entzündung, nur ohne Bakterien, ab.
Beim Kinderwunsch haben wir es oft mit folgenden Problemen im Bereich der Eileiter zu tun:
1. Ungünstige lokale neurovegetative Lage
2. Viel zu trockene Eileiter
3. Verkrampfungen der Eileitermuskulatur
4. Störungen der Eileiterperistaltik
5. Innere Verwachsungen im Eileiter
Bei all diesen Problemen kann die preiswerte, angenehme und ungefährliche vaginale Moorbehandlung besser, schneller und nachhaltiger helfen, als jede teure, schmerzhafte und gefährliche mikrochirurgische Operation.
Lösung für Problem Nr. 1
Wird der heiße Moortampon richtig bis in das hintere Scheidengewölbe platziert (hier werden manchmal Fehler gemacht!), so erwärmt er die in unmittelbarer Nähe liegenden neurovegetativen Frankenhäuserschen Ganglien. Sie werden dann für eine bessere neurovegetative Lage und Mikrozirkulation sorgen.
Lösung für Problem Nr. 2
Die heiße vaginale Moortamponade erwärmt auch die Arteria Uterina, die nur wenige Millimeter hinter dem hinteren Scheidengewölbe verläuft. Ihr warmes Blut wird nach oben entlang der Gebärmutter und der Eileiter bis zu den Eierstöcken transportiert. Unterwegs erreicht die Wärme tiefgründig alle Schichten dieser Organe.
Wir wissen bereits, dass die Erwärmung sowohl die Durchblutung als auch die Sekretion steigert. Auf diese Weise werden die sekretorischen Zellen zu einer Überproduktion der Endolymphe angeregt.
Lösung für Problem Nr. 3 und 4
Das warme Blut und die trophotrope Umstellung der Frankenhäuserschen Ganglien entkrampft auch die Spasmen der glatten Muskulatur und steigert ihre normale Peristaltik. Das wurde mehrmals mit in Vitro Versuchen nachgewiesen.
Bleibt nur noch der Höhepunkt der vaginalen Moorbehandlung zu erklären:
Lösung für Problem Nr. 5
Wie werden die Eileiter-Verwachsungen ohne jede Operation beseitigt?
Zuerst müssen wir uns erneut klar machen, dass die Verwachsungen im Eileiter eigentlich nur Fibrinverklebungen sind. Unter ihnen bleiben die zahlreichen gesunden sekretorischen Zellen eingeschlossen. Sie sind nur mit dem Fibrin-Klebstoff bedeckt. Sie sind nicht krank und nicht tot. Sie werden weiter mit Nährstoffen und Sauerstoff aus dem Blut versorgt und funktionieren daher weiter. Wir können sie mit einem richtig platzierten(!) heißen vaginalen Moortampon zur Überproduktion der Flüssigkeit anregen, und das sogar auf Distanz, wie wir das schon kennen, mit dem warmen Blut der Arteria Uterina über ihr Ramus tubarius.
Während der Moortamponade-Kur kann ein erfahrener Frauenarzt den Erfolg kontrollieren: Die feuchteren und daher dickeren Eileiter lassen sich oft als schmerzfreie(!), weiche Stränge ertasten. Das plötzliche Verschwinden dieses Tastbefunds spricht für die wieder erreichte Eileiterdurchgängigkeit. Mit der Ultraschalluntersuchung kann man es noch besser sehen. Es ist sinnvoll die gute Eileiterdurchgängigkeit durch eine entsprechende Untersuchung zu verifizieren, bevor ein Schwangerschaftsversuch vorgenommen wird.
Fibrin ist ein Klebstoff. In der Gebrauchsanleitung der meisten Klebstoffe steht, dass die zu verklebenden Stellen trocken sein müssen, damit der Klebstoff an ihnen haften kann. Jetzt können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn inmitten des Klebstoffs plötzlich viel Flüssigkeit erscheint, und sogar diffus.
Die Haftung eines jeden Klebstoffes wie Fibrin lässt mit der Befeuchtung schnell nach. Die Verwachsungen in den Eileitern lösen sich spontan und unblutig voneinander auf, ohne dass eine Verletzung entsteht und ohne dass eine neue Verwachsungsgefahr oder Vernarbung droht. Das frei gewordene Fibrin wird resorbiert.
Die durch Wärme ebenfalls angeregten peristaltischen Bewegungen der glatten Muskulatur der Eileiter helfen zusätzlich die zuvor verklebten Stellen voneinander zu trennen.
Ich kenne aus meiner Praxis noch zwei einfache Tricks für die Ärzte, um diesem sanften Trennungsprozess nachzuhelfen:
1. Die verdickten Eileiter lassen sich einzeln ertasten. Diese können mit beiden Händen einzeln vorsichtig massiert werden. Mit einer Hand in der Scheide und der anderen oben auf dem Bauch wird der Druck in den Eileitern sanft erhöht. Die aufgeweichten Verklebungen halten dem nicht Stand und lösen sich.
2. Es gibt handliche flache Vibrationsgeräte zu kaufen, die normalerweise zur Rückenbehandlung genutzt werden. In ihrer Gebrauchsanweisung wird oft davor gewarnt, das Gerät auf den Bauch zu setzen. Wenn Sie es auf den Unterleib setzen, droht überhaupt keine Gefahr. Wichtig ist: Die Harnblase musste immer voll sein. Die volle Harnblase wird bekanntlich zur Ultraschall-Untersuchung benötigt, weil die Flüssigkeit die mechanischen Ultraschallwellen bis an die Eileiter und darüber hinaus überträgt. Dasselbe Prinzip lässt sich auch bei der Unterbauch-Vibrations-Therapie nutzen, da es auch hier sich um mechanische Schwingungen handelt, die im Wasser gut weitergeleitet werden.
Die Vibrationen setzen kleinste Wasserquanten in Schwingung, die in den Eileiterverwachsungen noch eingeschlossenen sind. Die Flüssigkeit hat ein etwas anderes spezifische Gewicht als das festere Muskel- und Schleimhautgewebe. Daher kommt es zur unterschiedlichen Interferenz der Schwingung in all diesen Bereichen. Das Wasser wirkt hier wie eine Art des inneren Bollus, der hin und her gegen die Verklebung geworfen wird, bis diese nachgibt.
Mit der Lösung des letzten Problems steht der Schwangerschaft buchstäblich nichts mehr im Wege. Ich hoffe, der Sachverhalt ist Ihnen logisch und verständlich geworden?
Dazu wird eine längere Serie von heißen Moortamponaden angewandt. Je nach Schwere der Verwachsungen erstreckt sich die Behandlung manchmal über mehrere Zyklen nacheinander. Diese wärme-mechanische Therapie dürfen Sie unabhängig vom Zyklustag anwenden, mit Ausnahme der Periode, wo sie kontraindiziert ist (Endometriosegefahr!).
Nach Möglichkeit soll die vaginale Wärmebehandlung immer anschließend mit der transabdominalen Vibrationstherapie kombiniert werden.
Zusätzliche Möglichkeiten für Zuhause
Die Wechselwirkung des Halb- und Vollbades hat therapeutische Auswirkungen durch die Einpendelung der gesunden Vasomotorik: Der hydrostatische Druck-Unterdruckwechsel macht sich bis auf das subzelluläre Niveau bemerkbar. Er begünstigt Transportmechanismen an allen Membranen. Dies wirkt organerholend. Die Versorgung einzelner Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen, sowie ihre Entschlackung werden durch den Druck-/Unterdruckwechsel optimiert.
Ein Perlbad (Luftsprudelbad) bewirkt eine Mikromassagewirkung nachweislich noch in der Bauchhöhle. Das steigert die innere Lymphperistaltik, führt zur Entspannung, Muskeldetonisierung, Rezeptorenstimulation, Fazilitätswirkung, sexuelle Stimulierung, allgemeiner Anregung und neurovegetativer Umstimmung. Jedes warme Bad bewirkt eine reflektorische Spasmolyse der glatten Muskulatur bei Eileiter-Verkrampfungen.
-
Dr.Robert Kovarik
- Rang0
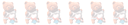
- Beiträge: 30
- Registriert: 19 Sep 2010 19:49
Das unterstützende Bad
Bei dem oben beschriebenen Vorgang kann man ein unterstützendes Wasserbad benutzen.
Seine Wärme spielt hier aber eine völlig andere Rolle als bei der, direkt im weiblichen Genitale platzierten heißen Moortamponade: Das innere Genitale wird nämlich von der äußerlich zugefügten Wärmeenergie wirksam geschützt. Wie, das erkläre ich ausführlich in dem nächsten Kapitel aus meinem Buch in meiner zweiten Antwort.
Die Badetemperatur soll nur die sogenannte Trophotropie, ein selbst erholender und selbst heilender, regenerativer Zustand des Organismus, den man sonst nur nachts im Schlaf oder tagsüber nur bei der Biotherik oder bei einer tiefen Meditation usw. kennt.
Es darf dabei unter keinen Umständen eine sympathikotonne Stresswirkung provoziert werden. Die passende Temperatur des 20-30 minütigen Bades darf zwischen 36 - 38 Grad Celsius liegen, wobei eine gewisse Abkühlungstendenz des Bades schon berücksichtigt ist. Eine begleitende Ruhe ist die Voraussetzung dazu.
Ansonsten werden hier nur die dynamischen, mechanischen Effekte eine nennenswerte Rolle spielen: Ein Druck-Unterdruck-Wechsel kann man nich zu Hause, sondern nur in Kurkliniken mit dortigen Möglichkeiten wirksam erreichen. Für zu Hause eignet sich eigentlich nur das intensive Luftsprudelbad, das Vibrationen bis in die Bauchhöhle transportiert. Sie sind zwar sanft, haben aber eine detonisierende, stresslindernde Wirkung.
Seine Wärme spielt hier aber eine völlig andere Rolle als bei der, direkt im weiblichen Genitale platzierten heißen Moortamponade: Das innere Genitale wird nämlich von der äußerlich zugefügten Wärmeenergie wirksam geschützt. Wie, das erkläre ich ausführlich in dem nächsten Kapitel aus meinem Buch in meiner zweiten Antwort.
Die Badetemperatur soll nur die sogenannte Trophotropie, ein selbst erholender und selbst heilender, regenerativer Zustand des Organismus, den man sonst nur nachts im Schlaf oder tagsüber nur bei der Biotherik oder bei einer tiefen Meditation usw. kennt.
Es darf dabei unter keinen Umständen eine sympathikotonne Stresswirkung provoziert werden. Die passende Temperatur des 20-30 minütigen Bades darf zwischen 36 - 38 Grad Celsius liegen, wobei eine gewisse Abkühlungstendenz des Bades schon berücksichtigt ist. Eine begleitende Ruhe ist die Voraussetzung dazu.
Ansonsten werden hier nur die dynamischen, mechanischen Effekte eine nennenswerte Rolle spielen: Ein Druck-Unterdruck-Wechsel kann man nich zu Hause, sondern nur in Kurkliniken mit dortigen Möglichkeiten wirksam erreichen. Für zu Hause eignet sich eigentlich nur das intensive Luftsprudelbad, das Vibrationen bis in die Bauchhöhle transportiert. Sie sind zwar sanft, haben aber eine detonisierende, stresslindernde Wirkung.
-
Dr.Robert Kovarik
- Rang0
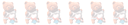
- Beiträge: 30
- Registriert: 19 Sep 2010 19:49
Warum vaginal?
Aus meinem Buch "Vaginale Moorbehandlung", www.biotherik.com.
Warum vaginal?
In etwa 95% der deutschen Frauenheilkurorte werden ausschließlich nur Moorbäder und Moorpackungen angewandt.
Leider!
Vaginale physikalische Anwendungen und insbesondere vaginale Moortamponaden werden in Deutschland kaum angeboten. Dies geschieht auf Grund der alten, irrtümlichen Vorstellung, dass ein heißes Moorbad völlig ausreicht, weil es den tiefen Körperkern, der sich unserer Wahrnehmung entzieht, genauso aufwärmen kann, wie wir es von der Körperschale kennen.
Das stimmt nicht.
Wieso? Reichen die bekannten Moorbäder nicht aus?
Nein. Die üblichen Moorwannenbäder sind gut, aber nicht optimal. Wir sind Warmblüter. Das bedeutet, dass unser Körper bestrebt ist, die Temperatur im Körperinneren konstant zu halten. Wird nun dem Körper Wärme über die Moorwannenbäder zugeführt, so wehrt sich der Körper, indem er versucht, diese zusätzliche Wärme über Schweißkühlung am Kopf und weitere innere Kreislaufmechanismen loszuwerden. Wenn diese Regelmechanismen nicht ausreichen, so entstehen unangenehme Hitzegefühle, Herzrasen, oder sogar Kolapsneigung. Das führt dazu, dass der Badende die weitere Wärmezufuhr (das Bad) schnellstmöglich beenden will.
Im Allgemeinen sind Bäder nicht ganz ungefährlich: Es gibt eine ganze Reihe ernster Gefahren, die zu beachten sind, die sogar lebensgefährlich sein können.
Das moderne, gynäko-balneologische Wissen lässt uns begreifen, warum das heiße Bad als Wärmeanwendung für das innere Genitale denkbar ungeeignet ist:
Die Temperaturneutralisierung im Bad
Das innere Genitale ist in wärmestabilem Körperkern des Körpers lokalisiert. Der Organismus ist bestrebt, die Temperatur im Körperkern im Bereich von etwa +37,3oC konstant zu halten. Dafür besitzt er mehrere effektive Regulationsmechanismen. Die Steigerung der Körperkerntemperatur im heißen Bad wird mit starkem Schwitzen begleitet.
Messungen zeigten, dass alleine die Abdünstung des Schweißes am Kopf die Erwärmung des inneren Genitale im Körperkern in dem üblichen heißen Bad weitgehend neutralisieren kann.
Die paradoxe Kühlung des inneren Genitale in heißem Bad
Der wärmekonstante Körperkern (innere Organe) wird von der wärmevariablen Körperschale (Muskel, Knochen, Haut) geschützt. Die Körperschale ist sehr groß. Sie beträgt die Hälfte der gesamten Körpermasse. Die Körperschale übt somit eine thermoregulatorische Ausgleichsfunktion aus, noch bevor andere Wärme-Gegenregulationen eingeschaltet werden.
Weil die Stoffwechselwärme in uns, da wir Warmblüter sind, ständig produziert und folglich auch abgeführt werden muss, entsteht ein abfallender Wärmegradient in der Körperschale.
Die Differenz der Temperatur der kühleren Körperschale zu der Temperatur des wärmeren Körperkerns wird als das "kalorische Defizit" bezeichnet. Das unausgeglichene kalorische Defizit ist dann für die "paradoxe Senkung der Kerntemperatur in heißem Bad" verantwortlich.
Dies geschieht auf folgende Weise:
Der starke Reiz des heißen Bades bewirkt eine sofortige Erweiterung aller Blutgefäße, sowohl im Körperkern als auch in der Körperschale. Dadurch strömt das warme Blut aus dem wärmeproduzierenden Kern verstärkt in die noch kühle Peripherie.
Somit beginnt die kühle Peripherie wärmer zu werden, aber zuerst auf Kosten des Blutes. Die Wärmeenergie strömt zwar schon von außen durch das heiße Bad, es geschieht aber relativ langsam. Die Erwärmung von außen braucht nämlich eine längere Zeit, um die große Masse der Körperschale auf einen höheren Wert als im Körperkern durchzuwärmen.
Somit dient die noch nicht aufgewärmte Körperschale zuerst wie ein Kühler für das warme Blut aus dem Körperkern. So funktioniert es bei einem Moorbad, nicht bei einem Moortampon.
Zurück zum Kern strömt daher zuerst nur das abgekühlte Blut, welches zur anfänglichen Abkühlung des Körperkerns führt. Die paradoxe Senkung der Kerntemperatur (auch im inneren Genitale) geschieht bei einem nicht ausgeglichenen kalorischen Defizit immer.
In heißem Bad dauert sie etwa 5-10 Minuten. Um diese Zeit verkürzt sich die Dauer der möglichen Aufwärmung des Körperkerns während des Badens. Das Erwärmungspotential des heißen Moorbades für das innere Genitale ist gering.
Die unangenehmen subjektiven Gefühle im Bad
Das innere Genitale kann von außen solange nicht erwärmt werden, solange die Wärmeabwehrmechanismen noch funktionieren. Dafür sorgt die mächtige, mehrstufige Wärmegegenregulation.
Anders gesagt: Der wärmestabile Körperkern kann mit der äußeren Wärme nur dann erreicht werden, wenn die wirksame Wärmeabwehr versagt. Und das ist unangenehm, das können Sie mir glauben!
Die unangenehme Hitze setzt zuerst den ältesten Wärme-Abwehrmechanismus in Gang. Wir nennen es die "Wärmeregulation durch das Verhalten". Über diese Wärmeabwehrfunktion verfügen schon die Kaltblüter-Organismen: Das begleitende unangenehme Hitzegefühl, das unangenehme Brennen an der Haut, das Schwindelgefühl bis zur Ohnmacht, sowie das Herzrasen in einem Überwärmungsbad führen zu solch unangenehmen Erlebnissen während des Bades, dass die Patientin einfach nicht gewillt ist, es länger zu ertragen und steigt aus um sich abzukühlen.
Hier werden Kühler am Kopf und Herzgegend angewandt. Sie mildern die Wärme für die inneren Organe zusätzlich.
Auch dies alles führt zu uneffektiver Verkürzung oder zur Abkühlung und somit zur Abschwächung des Bades aus Gründen der mangelnden Compliance (Kooperation).
Die objektiven Gefahren im Bad
So viele äußerliche Wärme und auch der Druck des Wassers (hydrostatische Druck) ist nicht nur subjektiv unangenehm, sondern birgt erhebliche Gefahren insbesondere für den Herzkreislauf. Es gibt viele Kontraindikationen des heißen Bades.
Dies führt dazu, dass die Intensität des Überwärmungsbades auf Grund von begleitenden, einschränkenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen resp. Schilddrüsenüberfunktion häufig absolut ungenügend für das innere Genitale verordnet werden darf.
Warum vaginal?
In etwa 95% der deutschen Frauenheilkurorte werden ausschließlich nur Moorbäder und Moorpackungen angewandt.
Leider!
Vaginale physikalische Anwendungen und insbesondere vaginale Moortamponaden werden in Deutschland kaum angeboten. Dies geschieht auf Grund der alten, irrtümlichen Vorstellung, dass ein heißes Moorbad völlig ausreicht, weil es den tiefen Körperkern, der sich unserer Wahrnehmung entzieht, genauso aufwärmen kann, wie wir es von der Körperschale kennen.
Das stimmt nicht.
Wieso? Reichen die bekannten Moorbäder nicht aus?
Nein. Die üblichen Moorwannenbäder sind gut, aber nicht optimal. Wir sind Warmblüter. Das bedeutet, dass unser Körper bestrebt ist, die Temperatur im Körperinneren konstant zu halten. Wird nun dem Körper Wärme über die Moorwannenbäder zugeführt, so wehrt sich der Körper, indem er versucht, diese zusätzliche Wärme über Schweißkühlung am Kopf und weitere innere Kreislaufmechanismen loszuwerden. Wenn diese Regelmechanismen nicht ausreichen, so entstehen unangenehme Hitzegefühle, Herzrasen, oder sogar Kolapsneigung. Das führt dazu, dass der Badende die weitere Wärmezufuhr (das Bad) schnellstmöglich beenden will.
Im Allgemeinen sind Bäder nicht ganz ungefährlich: Es gibt eine ganze Reihe ernster Gefahren, die zu beachten sind, die sogar lebensgefährlich sein können.
Das moderne, gynäko-balneologische Wissen lässt uns begreifen, warum das heiße Bad als Wärmeanwendung für das innere Genitale denkbar ungeeignet ist:
Die Temperaturneutralisierung im Bad
Das innere Genitale ist in wärmestabilem Körperkern des Körpers lokalisiert. Der Organismus ist bestrebt, die Temperatur im Körperkern im Bereich von etwa +37,3oC konstant zu halten. Dafür besitzt er mehrere effektive Regulationsmechanismen. Die Steigerung der Körperkerntemperatur im heißen Bad wird mit starkem Schwitzen begleitet.
Messungen zeigten, dass alleine die Abdünstung des Schweißes am Kopf die Erwärmung des inneren Genitale im Körperkern in dem üblichen heißen Bad weitgehend neutralisieren kann.
Die paradoxe Kühlung des inneren Genitale in heißem Bad
Der wärmekonstante Körperkern (innere Organe) wird von der wärmevariablen Körperschale (Muskel, Knochen, Haut) geschützt. Die Körperschale ist sehr groß. Sie beträgt die Hälfte der gesamten Körpermasse. Die Körperschale übt somit eine thermoregulatorische Ausgleichsfunktion aus, noch bevor andere Wärme-Gegenregulationen eingeschaltet werden.
Weil die Stoffwechselwärme in uns, da wir Warmblüter sind, ständig produziert und folglich auch abgeführt werden muss, entsteht ein abfallender Wärmegradient in der Körperschale.
Die Differenz der Temperatur der kühleren Körperschale zu der Temperatur des wärmeren Körperkerns wird als das "kalorische Defizit" bezeichnet. Das unausgeglichene kalorische Defizit ist dann für die "paradoxe Senkung der Kerntemperatur in heißem Bad" verantwortlich.
Dies geschieht auf folgende Weise:
Der starke Reiz des heißen Bades bewirkt eine sofortige Erweiterung aller Blutgefäße, sowohl im Körperkern als auch in der Körperschale. Dadurch strömt das warme Blut aus dem wärmeproduzierenden Kern verstärkt in die noch kühle Peripherie.
Somit beginnt die kühle Peripherie wärmer zu werden, aber zuerst auf Kosten des Blutes. Die Wärmeenergie strömt zwar schon von außen durch das heiße Bad, es geschieht aber relativ langsam. Die Erwärmung von außen braucht nämlich eine längere Zeit, um die große Masse der Körperschale auf einen höheren Wert als im Körperkern durchzuwärmen.
Somit dient die noch nicht aufgewärmte Körperschale zuerst wie ein Kühler für das warme Blut aus dem Körperkern. So funktioniert es bei einem Moorbad, nicht bei einem Moortampon.
Zurück zum Kern strömt daher zuerst nur das abgekühlte Blut, welches zur anfänglichen Abkühlung des Körperkerns führt. Die paradoxe Senkung der Kerntemperatur (auch im inneren Genitale) geschieht bei einem nicht ausgeglichenen kalorischen Defizit immer.
In heißem Bad dauert sie etwa 5-10 Minuten. Um diese Zeit verkürzt sich die Dauer der möglichen Aufwärmung des Körperkerns während des Badens. Das Erwärmungspotential des heißen Moorbades für das innere Genitale ist gering.
Die unangenehmen subjektiven Gefühle im Bad
Das innere Genitale kann von außen solange nicht erwärmt werden, solange die Wärmeabwehrmechanismen noch funktionieren. Dafür sorgt die mächtige, mehrstufige Wärmegegenregulation.
Anders gesagt: Der wärmestabile Körperkern kann mit der äußeren Wärme nur dann erreicht werden, wenn die wirksame Wärmeabwehr versagt. Und das ist unangenehm, das können Sie mir glauben!
Die unangenehme Hitze setzt zuerst den ältesten Wärme-Abwehrmechanismus in Gang. Wir nennen es die "Wärmeregulation durch das Verhalten". Über diese Wärmeabwehrfunktion verfügen schon die Kaltblüter-Organismen: Das begleitende unangenehme Hitzegefühl, das unangenehme Brennen an der Haut, das Schwindelgefühl bis zur Ohnmacht, sowie das Herzrasen in einem Überwärmungsbad führen zu solch unangenehmen Erlebnissen während des Bades, dass die Patientin einfach nicht gewillt ist, es länger zu ertragen und steigt aus um sich abzukühlen.
Hier werden Kühler am Kopf und Herzgegend angewandt. Sie mildern die Wärme für die inneren Organe zusätzlich.
Auch dies alles führt zu uneffektiver Verkürzung oder zur Abkühlung und somit zur Abschwächung des Bades aus Gründen der mangelnden Compliance (Kooperation).
Die objektiven Gefahren im Bad
So viele äußerliche Wärme und auch der Druck des Wassers (hydrostatische Druck) ist nicht nur subjektiv unangenehm, sondern birgt erhebliche Gefahren insbesondere für den Herzkreislauf. Es gibt viele Kontraindikationen des heißen Bades.
Dies führt dazu, dass die Intensität des Überwärmungsbades auf Grund von begleitenden, einschränkenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen resp. Schilddrüsenüberfunktion häufig absolut ungenügend für das innere Genitale verordnet werden darf.
nun lese ich dass diese wärmebehandlung mit moor kontraindiziert ist bei endometriose - und ich habe endometriose. ich habe grad 1-2 und bin beschwerdefrei. die endometriose wurde vor 3 monaten entfernt und befand sich im bereich zur blasenwand, douglasraum und lig. sacrouterinum.
der kiwu arzt hat diese woche im ultraschall irgendwelch schatten gesehen. er meinte dass wohl die rechte tube (wieder) zu ist. kann das sein?
ich habe 3-4 mal moortamponade gemacht, so warm war es nicht, aber die umschläge auf dem bauch waren schon wärmer. habe ich was angestellt..?
was wäre in dem fall die alternative?
der kiwu arzt hat diese woche im ultraschall irgendwelch schatten gesehen. er meinte dass wohl die rechte tube (wieder) zu ist. kann das sein?
ich habe 3-4 mal moortamponade gemacht, so warm war es nicht, aber die umschläge auf dem bauch waren schon wärmer. habe ich was angestellt..?
was wäre in dem fall die alternative?
-
Dr.Robert Kovarik
- Rang0
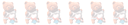
- Beiträge: 30
- Registriert: 19 Sep 2010 19:49
Moor und Endometriose
Vielleicht kann Ihnen diese Analyse der Kontraindikation der Moorbehandlung bei den verschiedenen Typen und Stadien der Endometriose helfen Ihre individuelle Situation besser zu beurteilen. Dies ist das Ergebnis der wissenschaftlichen Diskussion des Arbeitskreises "Gynäkologische Balneotherapie" im Verband Deutscher Badeärzte. Eventuell lassen Sie sich von Ihrem Frauenarzt, der Ihr Zustand exakt beurteilen kann, dabei helfen.
Endometriose
Die Endometriose wurde als eine Kontraindikation für die Moorbehandlung angesehen, weil angenommen wurde, dass Phytoöstrogene sich ungünstig auf dieses Krankheitsbild auswirken.
ASCHEIM und HOHLWEG konnten 1934 Östrogene erstmals im Torf nachweisen. 1953 und 1958 hat HOSEMANN in Tierversuchen zeigen können, dass östrogene Wirkstoffe aus dem Torf im Gegensatz zu natürlichen Steroiden bei der Leberpassage nicht aktiviert werden.1957 fand VELIKAY eine geringe östrogene Konzentration (1 mg Östrogen/Liter Torf). Die wasserunlöslichen lipidlöslichen Östrogene hatten keinen typischen Steroidcharakter, sondern es handelte sich hier lediglich um Seitenketten von Huminsäuren mit östrogener Wirkung. Diese Östrogene sind dazu noch durch die so genannte Eigenabsorption des Torfes gebunden. EICHELSDÖRFER vermutete 1968 humifizierte Produkte des Lignins mit phenolischem Charakter als Träger der östrogenen Wirksamkeit. 1980 fand NAUCKE im Torf wasserlösliche Konjugate steroidaler Verbindungen mit Steroidgrundgerüst (Zoosterine, Phytosterine, Mykosterine), die am C17 eine Seitenkette von 8 - 10 C-Atomen haben und die als Präkursoren dienen können.
Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Qualifizierung der Endometriose in die hormonabhängige und hormonunabhängige Erkrankung: SCHWEPPE, WYNN (1981) teilten die Endometriose in drei Typen ein:
Typ 1: Hochdifferenzierte Drüsen und hochdifferenzierte Struma mit ähnlichem Verhalten wie das Endometrium.
Typ 2: Abgeflachtes Epithel der Drüsen mit Organellenarmut und geringer Differenzierung. Dieses Epithel unterliegt keinen zyklischen Schwankungen.
Typ 3: Hochdifferenzierte Drüsenformationen, jedoch anderer Endstufen des Müller'schen Epithels als das Endometrium (Endocervix u.a.).Auch diese Drüsenformationen zeigen keine endokrine Modulation.
Nach den Studien waren von 94 untersuchten Präparaten nur 14 hochdifferenziert, nur 4 zeigten gewisse endokrinologische Modulation, aber im Sinne der Desynchronisation, der Verspätung gegenüber der jeweiligen Zyklusphase. Eine komplette sekretorische Transformation wurde niemals nachgewiesen. Die Frage der Östrogenrezeptoren bei der Endometriose untersuchten JÄNNE und Mitarbeiter (1981) und BERGVIST (1981). Sie fanden östrogene Rezeptoren nur bei 30% der Fälle: Die hormonelle Kontrolle in Endometrioseherden läuft anders ab als in eutropem Endometrium. Die Endometrioseherden sind kaum in der Lage, Östrogen- und Gestagen~Rezeptoren zu produzieren. Der endokrinologische Einfluss erscheint sekundär und hängt davon ab, inwieweit die individuelle Zelle differenziert ist.
Das kann die Erklärung dafür sein, dass die Endometriose gegenüber der Hormontherapie häufig resistent und die Rate der Rezidiven so hoch ist.
Wir können von dem o. g. Tatsachen die Unbedenklichkeit der Moortherapie bei der Endometriose ableiten.
Gründe für die Anwendung der Moortherapie bei der Endometriose können wie folgt spezifiziert werden:
1. Die Behandlung der aktiven Endometrioseherden ist sicherlich keine primäre Moorindikation. Allerdings ist es balneologisch möglich, den angestrebten hypohormonalen azyklischen Zustand nicht nur durch Gestagene, sondern auch durch balneologische Maßnahmen, u.a. durch begleitende Anregungsstrategien einzuleiten. Somit wird das ACTH-Adrenalinsystem stimuliert und die Gonadotropine werden gehemmt. Auch durch die Betonung der zeitgeberischen sympathikotonen Reize, besonders als Umkehrreize in der trophotropen präovulatorischen Phase, erreichen wir diesen Effekt.
2. Die Behandlung bei sekundärem Schaden der Endometriose. Dabei kommen die fibrolytischen Effekte der Wärme und der Moorinhaltsstoffe zur Geltung.
3. Die Behandlung bei sekundärem Schaden der üblichen Endometriosen- Therapie. Dabei handelt es sich hier hauptsächlich um postoperative Infiltrate und Verwachsungen.
FAZIT:
1 - Behandlung aktiver Herde:Typ 1: Kontraindikation der Resorption der Moorinhaltsstoffe. Dabei werden vaginale
Moorapplikation, rektale Moorapplikation und das „Trinkmoor“ kontraindiziert.
Mögliche Anwendungen bei Typ 1:
Vaginale Moorapplikation mit Plastikschutzhülle, Moorpackungen und Moorbäder (welche nur geringe Moorinhaltstofferesorption aufweisen.)
jede Mooranwendung unter der dauerhaften und gleichzeitigen Hormontherapie.
Typ 2 und Typ 3 stellen heute keine Kontraindikation der Moortherapie mehr dar, weil es sich hier um nicht-hormonabhängige Endometriose handelt.
Unbekannte Typen der Endometriose müssen wie Typ 1 mit Vorsicht behandelt werden.
2 - Sekundäre Folgen nach ausgeheilter Endometriose:Hierbei kann es sich höchstens um eine relative Kontraindikation bei Typ I und beim unbekannten Typ handeln, sofern die Patientin nicht wie üblich durch Hormontherapie dauerhaft behandelt wird.
3 - Sekundäre Folgen der Therapie:Hier gibt es keine Kontraindikation der Moortherapie mehr, auch nach der abgeschlossenen Hormontherapie nicht.
Endometriose
Die Endometriose wurde als eine Kontraindikation für die Moorbehandlung angesehen, weil angenommen wurde, dass Phytoöstrogene sich ungünstig auf dieses Krankheitsbild auswirken.
ASCHEIM und HOHLWEG konnten 1934 Östrogene erstmals im Torf nachweisen. 1953 und 1958 hat HOSEMANN in Tierversuchen zeigen können, dass östrogene Wirkstoffe aus dem Torf im Gegensatz zu natürlichen Steroiden bei der Leberpassage nicht aktiviert werden.1957 fand VELIKAY eine geringe östrogene Konzentration (1 mg Östrogen/Liter Torf). Die wasserunlöslichen lipidlöslichen Östrogene hatten keinen typischen Steroidcharakter, sondern es handelte sich hier lediglich um Seitenketten von Huminsäuren mit östrogener Wirkung. Diese Östrogene sind dazu noch durch die so genannte Eigenabsorption des Torfes gebunden. EICHELSDÖRFER vermutete 1968 humifizierte Produkte des Lignins mit phenolischem Charakter als Träger der östrogenen Wirksamkeit. 1980 fand NAUCKE im Torf wasserlösliche Konjugate steroidaler Verbindungen mit Steroidgrundgerüst (Zoosterine, Phytosterine, Mykosterine), die am C17 eine Seitenkette von 8 - 10 C-Atomen haben und die als Präkursoren dienen können.
Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Qualifizierung der Endometriose in die hormonabhängige und hormonunabhängige Erkrankung: SCHWEPPE, WYNN (1981) teilten die Endometriose in drei Typen ein:
Typ 1: Hochdifferenzierte Drüsen und hochdifferenzierte Struma mit ähnlichem Verhalten wie das Endometrium.
Typ 2: Abgeflachtes Epithel der Drüsen mit Organellenarmut und geringer Differenzierung. Dieses Epithel unterliegt keinen zyklischen Schwankungen.
Typ 3: Hochdifferenzierte Drüsenformationen, jedoch anderer Endstufen des Müller'schen Epithels als das Endometrium (Endocervix u.a.).Auch diese Drüsenformationen zeigen keine endokrine Modulation.
Nach den Studien waren von 94 untersuchten Präparaten nur 14 hochdifferenziert, nur 4 zeigten gewisse endokrinologische Modulation, aber im Sinne der Desynchronisation, der Verspätung gegenüber der jeweiligen Zyklusphase. Eine komplette sekretorische Transformation wurde niemals nachgewiesen. Die Frage der Östrogenrezeptoren bei der Endometriose untersuchten JÄNNE und Mitarbeiter (1981) und BERGVIST (1981). Sie fanden östrogene Rezeptoren nur bei 30% der Fälle: Die hormonelle Kontrolle in Endometrioseherden läuft anders ab als in eutropem Endometrium. Die Endometrioseherden sind kaum in der Lage, Östrogen- und Gestagen~Rezeptoren zu produzieren. Der endokrinologische Einfluss erscheint sekundär und hängt davon ab, inwieweit die individuelle Zelle differenziert ist.
Das kann die Erklärung dafür sein, dass die Endometriose gegenüber der Hormontherapie häufig resistent und die Rate der Rezidiven so hoch ist.
Wir können von dem o. g. Tatsachen die Unbedenklichkeit der Moortherapie bei der Endometriose ableiten.
Gründe für die Anwendung der Moortherapie bei der Endometriose können wie folgt spezifiziert werden:
1. Die Behandlung der aktiven Endometrioseherden ist sicherlich keine primäre Moorindikation. Allerdings ist es balneologisch möglich, den angestrebten hypohormonalen azyklischen Zustand nicht nur durch Gestagene, sondern auch durch balneologische Maßnahmen, u.a. durch begleitende Anregungsstrategien einzuleiten. Somit wird das ACTH-Adrenalinsystem stimuliert und die Gonadotropine werden gehemmt. Auch durch die Betonung der zeitgeberischen sympathikotonen Reize, besonders als Umkehrreize in der trophotropen präovulatorischen Phase, erreichen wir diesen Effekt.
2. Die Behandlung bei sekundärem Schaden der Endometriose. Dabei kommen die fibrolytischen Effekte der Wärme und der Moorinhaltsstoffe zur Geltung.
3. Die Behandlung bei sekundärem Schaden der üblichen Endometriosen- Therapie. Dabei handelt es sich hier hauptsächlich um postoperative Infiltrate und Verwachsungen.
FAZIT:
1 - Behandlung aktiver Herde:Typ 1: Kontraindikation der Resorption der Moorinhaltsstoffe. Dabei werden vaginale
Moorapplikation, rektale Moorapplikation und das „Trinkmoor“ kontraindiziert.
Mögliche Anwendungen bei Typ 1:
Vaginale Moorapplikation mit Plastikschutzhülle, Moorpackungen und Moorbäder (welche nur geringe Moorinhaltstofferesorption aufweisen.)
jede Mooranwendung unter der dauerhaften und gleichzeitigen Hormontherapie.
Typ 2 und Typ 3 stellen heute keine Kontraindikation der Moortherapie mehr dar, weil es sich hier um nicht-hormonabhängige Endometriose handelt.
Unbekannte Typen der Endometriose müssen wie Typ 1 mit Vorsicht behandelt werden.
2 - Sekundäre Folgen nach ausgeheilter Endometriose:Hierbei kann es sich höchstens um eine relative Kontraindikation bei Typ I und beim unbekannten Typ handeln, sofern die Patientin nicht wie üblich durch Hormontherapie dauerhaft behandelt wird.
3 - Sekundäre Folgen der Therapie:Hier gibt es keine Kontraindikation der Moortherapie mehr, auch nach der abgeschlossenen Hormontherapie nicht.
-
Dr.Robert Kovarik
- Rang0
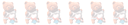
- Beiträge: 30
- Registriert: 19 Sep 2010 19:49
Moortampon- Temperatur
Hallo Nebulosa,
die 46 Grad C Temperatur wirkt kaum. Die übliche Moortamponade-Temperatur liegt bei 50 Grad C.
Alle notwendige Informationen für die richtige Anwendung finden Sie doch in meinem ausführlichen Buch, das ich in diesem Blog schon erwähnt habe.
Wenn man die Anwendung nicht richtig macht, ist das nur verschwendetes Geld und Zeit.
Also, zuerst sich gut informieren und erst dann anfangen! Nicht umgekehrt!
die 46 Grad C Temperatur wirkt kaum. Die übliche Moortamponade-Temperatur liegt bei 50 Grad C.
Alle notwendige Informationen für die richtige Anwendung finden Sie doch in meinem ausführlichen Buch, das ich in diesem Blog schon erwähnt habe.
Wenn man die Anwendung nicht richtig macht, ist das nur verschwendetes Geld und Zeit.
Also, zuerst sich gut informieren und erst dann anfangen! Nicht umgekehrt!
Sorry (vor allem an Maseb), ich war schon lange nicht mehr hier im Forum!
Die Adresse der Heilpraktikerin, die mir damals mit meinen verschlossenen Eileiter geholfen hat, schwanger zu werden, findet Ihr hier unter diesem Link:
http://www.natura-naturans.de
(Auch sehr interessant: http://www.natura-naturans.de/artikel/fruchtbarkeit.htm)
Liebe Grüße
Tiger
Die Adresse der Heilpraktikerin, die mir damals mit meinen verschlossenen Eileiter geholfen hat, schwanger zu werden, findet Ihr hier unter diesem Link:
http://www.natura-naturans.de
(Auch sehr interessant: http://www.natura-naturans.de/artikel/fruchtbarkeit.htm)
Liebe Grüße
Tiger



