Hallo zusammen,
bei mir wurde im Juni rheumatoide Arthritis festgestellt.
Auf Grund meines Kinderwunsches wurde ich bislang nur auf Cortison (Prednisolon - derzeit 6mg) eingestellt. Vorsorglich haben wir ein Spermiogramm bei meinem Mann machen lassen und das Ergebnis verheißt leider nichts Gutes: nur 2 Mio Spermien/ml.
Nachdem was wir jetzt hier im Forum gefunden haben, kommt wohl für uns nur eine ICSI in Frage. Da ich nicht weiß, wie lange ich noch mit Cortison zurecht kommen kann, möchte ich nun wissen, ob man eine künstliche Befruchtung auch unter einer Rheuma-Basismedikation durchführen kann. Mein Rheumatologe hatte im Hinblick auf die geplante (natürliche) Schwangerschaft Sulfasalazin oder Hydroxycholorquin in Erwägung gezogen.
Können Sie mir zu diesem Thema etwas sagen ???
Rheuma und künstliche Befruchtung
Moderator: Dr.Peet
Danke für die Beachtung
Hallo,
habe dazu auf der Homepage der dt. Rheuma gesellschaft etwas ganz gutes gefunden:
Techniken
Diagnostische Kriterien
Wirksamkeitskriterien der Therapie
Medikamentöse Therapie
Nichtsteroidale Antirheumatika
Glukokortikoide
Basistherapie
Patientenauf- klärungsbögen
Therapieempfehlungen
Radiosynoviorthese
Medikamentöse Schmerztherapie
Antirheumatische extern topische Therapie
Experimentelle Therapieprinzipien
Therapie in der Schwangerschaft
Außenseitermethoden der Therapie
Orthopädische Therapie
Physikalische Therapie
Ergotherapie
Diättherapie
Psychologische Betreuung
Soziale Betreuung
Rehabilitation
Strukturqualität der Rheumaambulanz
Strukturqualität akut- rheumatischer Kliniken
Kooperation Hausarzt und Rheumatologe
Patientenschulung
Begutachtung entzündliches Rheuma
5 Medikamentöse Therapie
5.10 Therapie in der Schwangerschaft
von E. Gromnica-Ihle, R. Fischer-Betz
Die meisten entzündlichen rheumatischen Erkrankungen betreffen bevorzugt das weibliche Geschlecht. Viele dieser Frauen sind im gebärfähigen Alter. Trotzdem liegen kontrollierte Studien über Sicherheit und Effizienz von Antirheumatika in der Schwangerschaft nur in geringer Zahl vor. Dies liegt zum einen daran, dass bei 75% der Frauen mit chronischer Polyarthritis die Krankheitsaktivität deutlich nachlässt, zum anderen für Erkrankungen wie den systemischen Lupus erythematodes erst seit wenigen Jahren Therapiekonzepte vorliegen, welche die Prognose so weit verbessert haben, dass über die Möglichkeit einer Schwangerschaft überhaupt erst nachgedacht wird. Zudem ist eine genaue Vorhersage über den Verlauf der Schwangerschaft für den Einzelfall nicht möglich. Immer mehr betroffene Frauen können sich heute ihren Kinderwunsch erfüllen. Die Therapie während der Gravidität ist darauf auszurichten, die Erkrankung in einem möglicht stabilen Zustand zu erhalten: Sie soll das Befinden der Mutter optimieren, ohne dabei dem Fetus zu schaden. In einigen Fällen dient eine Therapie auch der Behandlung des Feten.
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
Die Fertilität wird durch eine NSAR-Einnahme möglicherweise in Einzelfällen vermindert.
Einsatz in der Schwangerschaft
Über ihre Thrombozytenaggregationshemmung verstärken NSAR die Blutungsneigung von Mutter und Kind. Die tokolytische Wirkung kann zu einer prolongierten Schwangerschaft und Geburt führen. NSAR sind plazentagängig. Bei längerer Einnahme ist eine reversible verminderte renale Durchblutung mit geringerer fetaler Urinproduktion und Oligohydramnie möglich. Ferner ist eine Konstriktion des Ductus arteriosus im Uterus (v. a. um die 30. Schwangerschaftswoche) mit persistierender pulmonaler Hypertonie (mit und ohne Trikuspidalinsuffizienz) beschrieben.
Beachte: Somit gilt für den Einsatz der NSAR in der Gravidität:
* Wahl der niedrigsten effektiven Dosis,
* Bevorzugung von Präparaten mit kurzer Halbwertszeit,
* Anwendung nur bis zur 32. Schwangerschaftswoche.
* Über Coxibe fehlen Daten in der Schwangerschaft. Sie sollten daher nicht angewendet werden.
Besonderheiten
Azetylsalizylsäure bis 100 mg/Tag wird bei dem Antiphospholipidsyndrom zur Abortprophylaxe empfohlen. In einer amerikanischen Studie mit über 10 000 prospektiv untersuchten Schwangerschaften mit regelmäßiger oder vorübergehender Einnahme von ASS wurde kein erhöhtes Missbildungsrisiko festgestellt [16].
Stillen unter NSAR mit kurzer Halbwertszeit kann bei reifen Kindern erlaubt werden. Es scheint dabei günstig, das NSAR zum Zeitpunkt des Stillens einzunehmen, da dann die geringsten Mengen in der Milch nachgewiesen wurden [9, 17].
Glukokortikoide
Die Fertilität unter Glukokortikoiden ist nicht bedeutsam verändert.
Einsatz in der Schwangerschaft
Zu Glukokortikoiden liegen die meisten Erfahrungen in der Gravidität vor. Bei Gabe von Prednisolon beträgt die Nabelschnurkonzentration aufgrund des Plazentametabolismus etwa 20% der Konzentration im mütterlichen Blut. Prednison kann von der unreifen fetalen Leber nicht in den aktiven Metaboliten Prednisolon verwandelt werden. Dexamethason und Betamethason passieren hingegen ungehindert die Plazenta und sind im Bedarfsfall bei der Therapie des Fetus (z. B. Prophylaxe des kongenitalen AV-Blocks bei Kindern von Müttern mit Anti-SSA/Ro- und Anti-SSB/La-Antikörpern) einsetzbar. Ein Nutzen einer präventiven Gabe von Glukokortikoiden zur Verhinderung eine Exazerbation bei systemischem Lupus erythematodes (SLE) konnte nicht nachgewiesen werden [3]. Die Glukokortikoidgabe kann bei der Mutter dosisabhängig zu Diabetes mellitus, Hypertonie oder Präeklampsie führen. Infektionen, Osteoporse und vorzeitiger Blasensprung sind weitere Komplikationen. Eine intrauterine Wachstumsretardierung und eine Frühgeburt sind möglich. Einzelfälle mit fetalen Infektionen, adrenalen Insuffizienzen (1 : 1000) und neonatalem Katarakt sind beschrieben. Ein erhöhtes Missbildungsrisiko besteht nicht.
Beachte: Somit gilt für den Einsatz von Glukokortikoiden in der Gravidität:
* Therapie der Wahl bei Exazerbationen von rheumatischen Systemerkrankungen,
* Wahl der niedrigsten effektiven Dosis,
* keine prophylaktische Gabe,
* Bevorzugung von Prednison bzw. Prednisolon zur Therapie der Mutter,
* Osteoporoseprophylaxe mit Calcium und Vitamin D,
* Dexamethason bzw. Bethason zur Therapie des Kindes.
Stillen unter Prednison ist erlaubt. Bei Dosen über 20 mg/Tag ist nach Applikation der Medikamente möglichst eine Zeitdifferenz von 4 Stunden bis zum nächsten Stillen einzuhalten.
Chloroquin/Hydroxychloroquin
Die Fertilität wird durch die Antimalariamittel nicht sicher beeinflusst.
Einsatz in der Schwangerschaft
Chloroquin und Hydroxychloroquin sind plazentagängig. In Tierversuchen sind die Wirkstoffe in hohen Dosen embryotoxisch und teratogen. Beim Menschen wurden in Einzelfällen unter hohen Dosen Retinaveränderungen und Innenohrmissbildungen des Kindes beschrieben [4]. Bei Dosen unter 6,5 mg/kg/Tag beobachtete man in 900 Schwangerschaften kein erhöhtes Missbildungsrisiko [18]. Durch die lange Halbwertszeit der Antimalariamittel ist ein Absetzen bei bereits eingetretener Schwangerschaft für den Feten nicht mehr bedeutsam, da in der Organogenese noch eine Exposition vorliegt. Beim Absetzen in der Schwangerschaft wurden Aktivierungen des SLE beobachtet [3, 14].
Beachte: Somit gilt für den Einsatz der Antimalariamittel in der Gravidität:
* Bei geplanter Schwangerschaft sollte je nach klinischer Situation entweder nach Absetzen der Präparate 3–6 Monate vor Konzeption abgewartet werden oder die Schwangerschaft unter der Medikation geplant werden.
* Tritt eine ungeplante Schwangerschaft unter der Therapie auf, wird empfohlen, die Therapie fortzusetzen, da eine Aktivierung der Erkrankung für den Ausgang der Schwangerschaft unvorteilhaft sein kann.
Beide Präparate sind allerdings in Deutschland außer zur Malariaprophylaxe und- therapie in der Schwangerschaft nicht zugelassen.
Stillen
Hydroxychloroquin kann in der Muttermilch nachgewiesen werden [10]. Da es zu Kumulationen kommen kann und damit Wirkungen auf das Kind möglich sind, wird Stillen unter Chloroquin- oder Hydroxychloroquintherapie nicht empfohlen!
Sulfasalazin
Sulfasalazin kann beim Mann zu einer reversiblen Oligospermie führen.
Einsatz in der Schwangerschaft
Die Kenntnisse über die Anwendung von Sulfasalazin in der Gravidität stammen vorwiegend aus dem Einsatz bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Obwohl Sulfasalazin und seine Metaboliten die Plazenta passieren, zeigen Untersuchungen an mehr als 2000 Schwangerschaften keinen negativen Einfluss auf das Kind und Schwangerschaftsoutcome [8]. Bei chronischer Polyarthritis ist der Einsatz des Präparates – falls erforderlich – in der Gravidität möglich mit Folsäuresupplementation. Kurz vor der Geburt ist jedoch die Therapie zu beenden, da – wie bei anderen Sulfonamiden auch – die Möglichkeit des Auftretens einer Gelbsucht und eines Kernikterus gegeben ist.
Unter Sulfasalazin scheinen keine größeren Risiken für das Stillen des Kindes zu bestehen [7].
Gold (Aurothiomalat)
Zur Fertilität unter Goldtherapie existieren keine Daten.
Einsatz in der Schwangerschaft
Es existieren nur sehr wenig Daten bzgl. der Anwendung in der Schwangerschaft. Goldsalze passieren die Plazenta. Aus Tierstudien sind dosisabhängige Wachstumsstörungen und Missbildungen unter Aurothiomalat bekannt. Beim Menschen gibt es wenig Hinweise auf teratogene Effekte. Die Anwendung ist in der Gravität nicht zugelassen. Bei strikter Indikationsstellung wegen aktiver chronischer Polyarthritis ist die Anwendung in Ausnahmefällen möglich. Dabei wird empfohlen, die Dosierungsintervalle zu verlängern und die Dosis zu reduzieren [1, 11].
Beachte: Somit gilt für den Einsatz von Aurothiomalat in der Gravidität:
* Es sollte 6 Monate vor einer geplanten Schwangerschaft abgesetzt werden.
Vom Stillen wird unter oraler Goldtherapie abgeraten, da signifikante Dosen in der Muttermilch nachgewiesen wurden. Eine i. m.-Goldtherapie scheint dagegen weiter fortgeführt werden zu können [11]
Methotrexat
Die Fertilität der Frauen wird durch Methotrexat nicht beeinträchigt. Bei Männern kann eine reversible Oligospermie entstehen.
Einsatz in der Schwangerschaft
Im Tierversuch sind bei Methotrexatgabe sowohl intrauteriner Fruchttod als auch Missbildungen beschrieben. Methotrexat ist plazentagängig und wirkt insbesondere im ersten Trimenon abortiv. Es besteht eine strikte Kontraindikation für den Einsatz der Substanz in der Schwangerschaft [5, 6].
Beachte: Somit gilt für den Einsatz von Methotrexat in der Gravidität:
* Eine Methotrexattherapie muss mindestens 3 Monate, besser 6 Monate vor einer geplanten Schwangerschaft abgesetzt werden.
Entsprechend gilt dies auch für die Behandlung des männlichen Partners.
Stillen ist unter Methotrexat wegen eines Nachweises in der Muttermilch nicht möglich [15].
Azathioprin
Die verminderte Effektivität eines Intrauterinpessars ist unter Azathioprintherapie beschrieben [2].
Einsatz in der Schwangerschaft
In Tierversuchen war Azathioprin in hohen Dosen teratogen (Skelett- und ZNS-Abnormalitäten). Beim Menschen scheint das Risiko für kindliche Anomalien nach den bisher publizierten Daten nicht erhöht zu sein, in einer Recherche bzgl. 700 nierentransplantierter Patientinnen wurden bei 4,3% kindliche Anomalien beobachtet (gegenüber einer Häufigkeit zwischen 1 und 4% ohne Azathioprin [2, 5]. Berichte über die Anwendung von Azathioprin in der Schwangerschaft beim SLE zeigen keine erhöhte Missbildungsrate bei den Neugeborenen. Azathioprin ist plazentagängig, die fetale Leber kann die Umwandlung in den aktiven Metaboliten 6-Mercaptopurin nicht leisten. Mögliche Auswirkungen auf das Kind sind Wachstumsretardierung und Immunsuppression. Frühgeburten wurden häufiger beschrieben [5]. Azathioprin ist in Deutschland während der Schwangerschaft nicht zugelassen.
Beachte: Somit gilt für den Einsatz von Azathioprin in der Gravidität:
* Empfohlen wird, das Medikament 6 Monate vor einer geplanten Gravidität abzusetzen. Entsprechendes gilt auch für den Mann, der Azathioprin erhält.
Unter Abwägung von Nutzen für die Mutter und den anscheinend kleinen Risiken für den Feten kann in Einzelfällen von diesem Vorgehen abgewichen werden. Dies gilt insbesondere für eine bereits eingetretene Schwangerschaft.
Stillen unter Azathioprin ist wegen der Gefahr einer Immunsuppression beim Kind nicht erlaubt [7].
Cyclophosphamid
Unter Cyclophosphamid ist mit Amenorrhö und Infertilität zu rechnen.
Einsatz in der Schwangerschaft
Cyclophosphamid ist in der Schwangerschaft wegen Fetotoxizität und Teratogenität kontraindiziert. Das Präparat ist 6 Monate vor der geplanten Schwangerschaft abzusetzen. Tritt unter einer Therapie eine Schwangerschaft ein, besteht eine Indikation zur Interruptio.
Cyclophosphamid ist während der Stillzeit kontraindiziert.
Ciclosporin
Durch Ciclosporin wird die Fertilität nicht sicher beeinflusst.
Einsatz in der Schwangerschaft
Ciclosporin A kann in der Schwangerschaft in der niedrigsten effektiven Dosis fortgeführt werden unter regelmäßigen Kontrollen von Blutdruck und Nierenfunktion.
Im Tierversuch wurde keine Teratogenität nachgewiesen. Über die Sicherheit der Anwendung bei Schwangeren liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Bei nierentransplantierten Schwangeren wurden in 40% eine Wachstumsretardierung und Frühgeburten beschrieben. Es wird auch über vereinzelte Missbildungen bei Neugeborenen, deren Mütter in der Schwangerschaft Ciclosporin erhielen, berichtet [1]. Die Langzeiteffekte auf das Kind, das im Uterus eine entsprechende Exposition erhielt, sind noch völlig unbekannt. Eine eindeutige Empfehlung kann daher nicht gegeben werden.
Stillen unter Ciclosporin ist aufgrund der immunsuppressiven Auswirkungen auf das Kind kontraindiziert [7].
Mycofenolsäure
Mycofenolsäure ist während der Schwangerschaft kontraindiziert. Es sollte 6 Wochen vor Beginn einer Schwangerschaft abgesetzt werden.
Etanercept, Infliximab und Adalimumab
Zum Einfluss von Etanercept und Infliximab auf die Fertilität gibt es keine validen Daten.
Einsatz in der Schwangerschaft
Im Gegensatz zu vielen anderen krankheitsmodifizierenden Medikamenten konnte im Tierversuch keine Teratogenität oder Fetotoxizität nachgewiesen werden. Einzelne Fallberichte zu Frauen, die unter Therapie mit Etanercept oder Infliximab schwanger geworden sind, zeigen keine Hinweise auf eine höhere Komplikations- oder Missbildungsrate. Ausreichende Erfahrungen mit der Therapie während einer Schwangerschaft liegen aber zur Zeit nicht vor.
Bei Frauen muss daher während der Behandlung mit Etanercept und vorsichtshalber bis zu 3 Monaten (Infliximab: bis zu 6 Monaten) nach Therapieende eine sichere Kontrazeption erfolgen. Auch Männer sollten während der Behandlung und bis zu 3 Monate (Infliximab: bis zu 6 Monate) nach Therapieende keine Kinder zeugen.
Für eine unter Therapie eingetretene Schwangerschaft existiert nach heutiger Datenlage keine absolute Indikation zur Interruptio. Bei Wunsch der Betroffenen nach Aufklärung über die zur Zeit unsichere Datenlage kann eine Interruptio aus medizinischer Indikation aber befürwortet werden.
Vom Stillen unter Etanercept, Infliximab und Adalimumab ist aufgrund der bislang nicht bekannten Auswirkungen auf das Kind abzuraten.
Immunadsorption und Plasmapherese
In Ausnahmefällen können bei unzureichender Wirkung von z. B. Steroiden extrakorporale Verfahren in der Schwangerschaft durchgeführt werden.
Immunglobuline
Bei Exazerbationen können auch Immunglobuline in der Schwangerschaft eingesetzt werden [12, 13].
Planung einer Schwangerschaft
Die Behandlungsstrategie hängt davon ab, ob die rheumatische Erkrankung bereits vor der Schwangerschaft bekannt ist. In diesem Fall sollte die Schwangerschaft mit dem behandelnden Arzt geplant werden, um einen möglichst günstigen Zeitpunkt zu wählen. Die Schwangerschaft sollte in eine möglichst inaktive Phase fallen. Bei einer Erkrankung in Remission stellt auch die Schwangerschaft keine Notwendigkeit zur Therapie dar. Eine bereits bestehende Therapie wird auf ihre Notwendigkeit hin überprüft. Wenn es die Krankheitsaktivität erlaubt, können Medikamente gezielt abgesetzt werden. Die Schwangerschaft sollte frühestens nach 3–4 Monaten nach Beendigung der Therapie beginnen, da das Absetzen der Medikamente einen Schub auslösen kann. Falls eine Aktivierung eintritt, ist die Planung einer Schwangerschaft evtl. auch unter einer Therapie (Kortison, Hydroxychloroquin, Azthioprin) möglich.
Tritt ein Schub der Erkrankung auf, sollte zunächst ein Steroidstoß durchgeführt werden. Diese Behandlung unterdrückt die Symptomatik ausreichend gut. Reicht diese Medikation nicht aus, stehen mit Immunglobulinen, Azathioprin und extrakorporalen Verfahren ergänzende Maßnahmen zur Verfügung. In aktiven Phasen von Organbeteiligungen, z. B. einer behandlungspflichtigen Nierenbeteiligung beim SLE, sollte von einer Schwangerschaft abgeraten werden: Es besteht ein zu hohes Risiko für eine Verschlechterung bis hin zur terminalen Niereninsuffizienz. Eine absolute Kontraindikation gegen eine Schwangerschaft stellen schwere Funktionseinschränkungen von Organen und eine zentralnervöse Beteiligung (z. B. ein vorangegangener Insult) beim Antiphospholipidsyndrom dar. Unter Immunsuppression ist die Indikation zur Aminozentese eher großzügig zu stellen, sonographische Untersuchungen an gynäkologischen Zentren zum Ausschluss von Missbildungen werden in der 18.–20. Schwangerschaftswoche empfohlen. Bei Bewegungseinschränkungen im Hüftgelenk oder aktiver Symphysitis bzw. Sakroiliitis sollte der Entbindungsmodus festgelegt werden. Die Schwangerschaft sollte insgesamt als Risikogravidität aufgefasst und ein regelmäßiges immunologisches und gynäkologisches Monitoring in jedem Trimenon der Schwangerschaft sowie post partum durchgeführt werden.
Literatur
1. Antoni CE, Furst D, Manger B et al (2001) Outcome of pregnancy in women receiving Remicade (infliximab) for the treatment of Crohn’s disease or rheumatoid arthritis (abstract) Arthritis Rheum 44(suppl):S 153
2. Brooks PM, Needs CJ (1990) Antirheumatic drugs in pregnancy and lactation. Baillieres Clin Rheumatol 4:157–171
3. Chakravarty EF, Sanchez-Yamamoto D, Bush TM (2003) The use of disease modifying antirheumatic drugs in women with rheumatoid arthritis of childbearing age: a survey of practice patterns and pregnancy outcomes. J Rheumatol 30(2):241–246
4. Davidson JM, Lindheimer MD (1982) Pregnancy in renal transplant recipients. J Reprod Me 27:613–621
5. Derksen RHWM, Bruinse HW, de Groot PG, Kater L (1994) Pregnancy in systemic lupus erythematosus: a prospective study. Lupus 3:149–155
6. Hart CN, Naunton RF (1964) The ototoxicity of chloroquine phosphate. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 80:407–412
7. Jarvis B, Faulds D (1999) Etanercept: a review of its use in rheumatoid arthritis. Drugs 57:945–966
8. Johns DG, Rutherford LD, Leighton PC, Vogel CL (1972) Secretion of methotrexate into human milk. Am J Obstet Gynecol 112:978–980
9. Needs CJ, Brooks PM (1985) Antirheumatic medication in pregnancy. Br J Rheumatol 24:282–290
10. Ostensen M (2006) Antirheumatic therapy and reproduction. The influence on fertility, pregnancy and breast feeding. Z Rheumatol 65:217–224
11. Ostensen M (1994) Optimization of antirheumatic drug treatment in pregnancy. Clin Pharmacokinet 27:486–503
12. Ostensen M (1998) Nonsteroidal anit-inflammatory drugs during pregnancy. Scand J Rheumatol Suppl 107:128–132
13. Ostensen M, Brown ND, Chiang PK, Aarbakke J (1985) Hydroxychloroquine in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 28:357
14. Ostensen M, Skavdal K, Myklebust G, Tomassen Y, Aarbackke J (1986) Excretion of gold into human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 31:251–252
15. Parke A (1992) The role of IVIG in the management of patients with antiphospholipid antibodies and recurrent pregnancy losses. Clin Rev Allergy 10:105–118
16. Parke AL (1998) Intravenous gammaglobulin in pregnancy, the Connecticut experience. Scand J Rheumatol Suppl 107:103–104
17. Parke A, West B (1996) Hydroxychloroquine in pregnant patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 10:1715–1718
18. Roubenoff R, Hoyt J, Petri M et al (1988) Effects of antiinflammatory and immunosuppressive drugs on pregnancy and fertility. Sem Arthr Rheum 18:88–110
19. Slone D, Heinonen OP, Kaufmann DW et al (1976) Aspirin and congenital malformations. Lancet 1373–1375
20. Townsend RJ, Bendetti TJ, Erickson SH, Cengiz C, Gillespie WR, Gschwend J, Albert KS (1984) Exretion of ibuprofen in breast milk. Am J Obstet Gynecol 149:184–186
21. Wolfe MS, Cordero JF (1985) Safety of chloroquine in chemosuppression of malaria during pregnancy. Br Med J 290:1466–1467
habe dazu auf der Homepage der dt. Rheuma gesellschaft etwas ganz gutes gefunden:
Techniken
Diagnostische Kriterien
Wirksamkeitskriterien der Therapie
Medikamentöse Therapie
Nichtsteroidale Antirheumatika
Glukokortikoide
Basistherapie
Patientenauf- klärungsbögen
Therapieempfehlungen
Radiosynoviorthese
Medikamentöse Schmerztherapie
Antirheumatische extern topische Therapie
Experimentelle Therapieprinzipien
Therapie in der Schwangerschaft
Außenseitermethoden der Therapie
Orthopädische Therapie
Physikalische Therapie
Ergotherapie
Diättherapie
Psychologische Betreuung
Soziale Betreuung
Rehabilitation
Strukturqualität der Rheumaambulanz
Strukturqualität akut- rheumatischer Kliniken
Kooperation Hausarzt und Rheumatologe
Patientenschulung
Begutachtung entzündliches Rheuma
5 Medikamentöse Therapie
5.10 Therapie in der Schwangerschaft
von E. Gromnica-Ihle, R. Fischer-Betz
Die meisten entzündlichen rheumatischen Erkrankungen betreffen bevorzugt das weibliche Geschlecht. Viele dieser Frauen sind im gebärfähigen Alter. Trotzdem liegen kontrollierte Studien über Sicherheit und Effizienz von Antirheumatika in der Schwangerschaft nur in geringer Zahl vor. Dies liegt zum einen daran, dass bei 75% der Frauen mit chronischer Polyarthritis die Krankheitsaktivität deutlich nachlässt, zum anderen für Erkrankungen wie den systemischen Lupus erythematodes erst seit wenigen Jahren Therapiekonzepte vorliegen, welche die Prognose so weit verbessert haben, dass über die Möglichkeit einer Schwangerschaft überhaupt erst nachgedacht wird. Zudem ist eine genaue Vorhersage über den Verlauf der Schwangerschaft für den Einzelfall nicht möglich. Immer mehr betroffene Frauen können sich heute ihren Kinderwunsch erfüllen. Die Therapie während der Gravidität ist darauf auszurichten, die Erkrankung in einem möglicht stabilen Zustand zu erhalten: Sie soll das Befinden der Mutter optimieren, ohne dabei dem Fetus zu schaden. In einigen Fällen dient eine Therapie auch der Behandlung des Feten.
Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)
Die Fertilität wird durch eine NSAR-Einnahme möglicherweise in Einzelfällen vermindert.
Einsatz in der Schwangerschaft
Über ihre Thrombozytenaggregationshemmung verstärken NSAR die Blutungsneigung von Mutter und Kind. Die tokolytische Wirkung kann zu einer prolongierten Schwangerschaft und Geburt führen. NSAR sind plazentagängig. Bei längerer Einnahme ist eine reversible verminderte renale Durchblutung mit geringerer fetaler Urinproduktion und Oligohydramnie möglich. Ferner ist eine Konstriktion des Ductus arteriosus im Uterus (v. a. um die 30. Schwangerschaftswoche) mit persistierender pulmonaler Hypertonie (mit und ohne Trikuspidalinsuffizienz) beschrieben.
Beachte: Somit gilt für den Einsatz der NSAR in der Gravidität:
* Wahl der niedrigsten effektiven Dosis,
* Bevorzugung von Präparaten mit kurzer Halbwertszeit,
* Anwendung nur bis zur 32. Schwangerschaftswoche.
* Über Coxibe fehlen Daten in der Schwangerschaft. Sie sollten daher nicht angewendet werden.
Besonderheiten
Azetylsalizylsäure bis 100 mg/Tag wird bei dem Antiphospholipidsyndrom zur Abortprophylaxe empfohlen. In einer amerikanischen Studie mit über 10 000 prospektiv untersuchten Schwangerschaften mit regelmäßiger oder vorübergehender Einnahme von ASS wurde kein erhöhtes Missbildungsrisiko festgestellt [16].
Stillen unter NSAR mit kurzer Halbwertszeit kann bei reifen Kindern erlaubt werden. Es scheint dabei günstig, das NSAR zum Zeitpunkt des Stillens einzunehmen, da dann die geringsten Mengen in der Milch nachgewiesen wurden [9, 17].
Glukokortikoide
Die Fertilität unter Glukokortikoiden ist nicht bedeutsam verändert.
Einsatz in der Schwangerschaft
Zu Glukokortikoiden liegen die meisten Erfahrungen in der Gravidität vor. Bei Gabe von Prednisolon beträgt die Nabelschnurkonzentration aufgrund des Plazentametabolismus etwa 20% der Konzentration im mütterlichen Blut. Prednison kann von der unreifen fetalen Leber nicht in den aktiven Metaboliten Prednisolon verwandelt werden. Dexamethason und Betamethason passieren hingegen ungehindert die Plazenta und sind im Bedarfsfall bei der Therapie des Fetus (z. B. Prophylaxe des kongenitalen AV-Blocks bei Kindern von Müttern mit Anti-SSA/Ro- und Anti-SSB/La-Antikörpern) einsetzbar. Ein Nutzen einer präventiven Gabe von Glukokortikoiden zur Verhinderung eine Exazerbation bei systemischem Lupus erythematodes (SLE) konnte nicht nachgewiesen werden [3]. Die Glukokortikoidgabe kann bei der Mutter dosisabhängig zu Diabetes mellitus, Hypertonie oder Präeklampsie führen. Infektionen, Osteoporse und vorzeitiger Blasensprung sind weitere Komplikationen. Eine intrauterine Wachstumsretardierung und eine Frühgeburt sind möglich. Einzelfälle mit fetalen Infektionen, adrenalen Insuffizienzen (1 : 1000) und neonatalem Katarakt sind beschrieben. Ein erhöhtes Missbildungsrisiko besteht nicht.
Beachte: Somit gilt für den Einsatz von Glukokortikoiden in der Gravidität:
* Therapie der Wahl bei Exazerbationen von rheumatischen Systemerkrankungen,
* Wahl der niedrigsten effektiven Dosis,
* keine prophylaktische Gabe,
* Bevorzugung von Prednison bzw. Prednisolon zur Therapie der Mutter,
* Osteoporoseprophylaxe mit Calcium und Vitamin D,
* Dexamethason bzw. Bethason zur Therapie des Kindes.
Stillen unter Prednison ist erlaubt. Bei Dosen über 20 mg/Tag ist nach Applikation der Medikamente möglichst eine Zeitdifferenz von 4 Stunden bis zum nächsten Stillen einzuhalten.
Chloroquin/Hydroxychloroquin
Die Fertilität wird durch die Antimalariamittel nicht sicher beeinflusst.
Einsatz in der Schwangerschaft
Chloroquin und Hydroxychloroquin sind plazentagängig. In Tierversuchen sind die Wirkstoffe in hohen Dosen embryotoxisch und teratogen. Beim Menschen wurden in Einzelfällen unter hohen Dosen Retinaveränderungen und Innenohrmissbildungen des Kindes beschrieben [4]. Bei Dosen unter 6,5 mg/kg/Tag beobachtete man in 900 Schwangerschaften kein erhöhtes Missbildungsrisiko [18]. Durch die lange Halbwertszeit der Antimalariamittel ist ein Absetzen bei bereits eingetretener Schwangerschaft für den Feten nicht mehr bedeutsam, da in der Organogenese noch eine Exposition vorliegt. Beim Absetzen in der Schwangerschaft wurden Aktivierungen des SLE beobachtet [3, 14].
Beachte: Somit gilt für den Einsatz der Antimalariamittel in der Gravidität:
* Bei geplanter Schwangerschaft sollte je nach klinischer Situation entweder nach Absetzen der Präparate 3–6 Monate vor Konzeption abgewartet werden oder die Schwangerschaft unter der Medikation geplant werden.
* Tritt eine ungeplante Schwangerschaft unter der Therapie auf, wird empfohlen, die Therapie fortzusetzen, da eine Aktivierung der Erkrankung für den Ausgang der Schwangerschaft unvorteilhaft sein kann.
Beide Präparate sind allerdings in Deutschland außer zur Malariaprophylaxe und- therapie in der Schwangerschaft nicht zugelassen.
Stillen
Hydroxychloroquin kann in der Muttermilch nachgewiesen werden [10]. Da es zu Kumulationen kommen kann und damit Wirkungen auf das Kind möglich sind, wird Stillen unter Chloroquin- oder Hydroxychloroquintherapie nicht empfohlen!
Sulfasalazin
Sulfasalazin kann beim Mann zu einer reversiblen Oligospermie führen.
Einsatz in der Schwangerschaft
Die Kenntnisse über die Anwendung von Sulfasalazin in der Gravidität stammen vorwiegend aus dem Einsatz bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Obwohl Sulfasalazin und seine Metaboliten die Plazenta passieren, zeigen Untersuchungen an mehr als 2000 Schwangerschaften keinen negativen Einfluss auf das Kind und Schwangerschaftsoutcome [8]. Bei chronischer Polyarthritis ist der Einsatz des Präparates – falls erforderlich – in der Gravidität möglich mit Folsäuresupplementation. Kurz vor der Geburt ist jedoch die Therapie zu beenden, da – wie bei anderen Sulfonamiden auch – die Möglichkeit des Auftretens einer Gelbsucht und eines Kernikterus gegeben ist.
Unter Sulfasalazin scheinen keine größeren Risiken für das Stillen des Kindes zu bestehen [7].
Gold (Aurothiomalat)
Zur Fertilität unter Goldtherapie existieren keine Daten.
Einsatz in der Schwangerschaft
Es existieren nur sehr wenig Daten bzgl. der Anwendung in der Schwangerschaft. Goldsalze passieren die Plazenta. Aus Tierstudien sind dosisabhängige Wachstumsstörungen und Missbildungen unter Aurothiomalat bekannt. Beim Menschen gibt es wenig Hinweise auf teratogene Effekte. Die Anwendung ist in der Gravität nicht zugelassen. Bei strikter Indikationsstellung wegen aktiver chronischer Polyarthritis ist die Anwendung in Ausnahmefällen möglich. Dabei wird empfohlen, die Dosierungsintervalle zu verlängern und die Dosis zu reduzieren [1, 11].
Beachte: Somit gilt für den Einsatz von Aurothiomalat in der Gravidität:
* Es sollte 6 Monate vor einer geplanten Schwangerschaft abgesetzt werden.
Vom Stillen wird unter oraler Goldtherapie abgeraten, da signifikante Dosen in der Muttermilch nachgewiesen wurden. Eine i. m.-Goldtherapie scheint dagegen weiter fortgeführt werden zu können [11]
Methotrexat
Die Fertilität der Frauen wird durch Methotrexat nicht beeinträchigt. Bei Männern kann eine reversible Oligospermie entstehen.
Einsatz in der Schwangerschaft
Im Tierversuch sind bei Methotrexatgabe sowohl intrauteriner Fruchttod als auch Missbildungen beschrieben. Methotrexat ist plazentagängig und wirkt insbesondere im ersten Trimenon abortiv. Es besteht eine strikte Kontraindikation für den Einsatz der Substanz in der Schwangerschaft [5, 6].
Beachte: Somit gilt für den Einsatz von Methotrexat in der Gravidität:
* Eine Methotrexattherapie muss mindestens 3 Monate, besser 6 Monate vor einer geplanten Schwangerschaft abgesetzt werden.
Entsprechend gilt dies auch für die Behandlung des männlichen Partners.
Stillen ist unter Methotrexat wegen eines Nachweises in der Muttermilch nicht möglich [15].
Azathioprin
Die verminderte Effektivität eines Intrauterinpessars ist unter Azathioprintherapie beschrieben [2].
Einsatz in der Schwangerschaft
In Tierversuchen war Azathioprin in hohen Dosen teratogen (Skelett- und ZNS-Abnormalitäten). Beim Menschen scheint das Risiko für kindliche Anomalien nach den bisher publizierten Daten nicht erhöht zu sein, in einer Recherche bzgl. 700 nierentransplantierter Patientinnen wurden bei 4,3% kindliche Anomalien beobachtet (gegenüber einer Häufigkeit zwischen 1 und 4% ohne Azathioprin [2, 5]. Berichte über die Anwendung von Azathioprin in der Schwangerschaft beim SLE zeigen keine erhöhte Missbildungsrate bei den Neugeborenen. Azathioprin ist plazentagängig, die fetale Leber kann die Umwandlung in den aktiven Metaboliten 6-Mercaptopurin nicht leisten. Mögliche Auswirkungen auf das Kind sind Wachstumsretardierung und Immunsuppression. Frühgeburten wurden häufiger beschrieben [5]. Azathioprin ist in Deutschland während der Schwangerschaft nicht zugelassen.
Beachte: Somit gilt für den Einsatz von Azathioprin in der Gravidität:
* Empfohlen wird, das Medikament 6 Monate vor einer geplanten Gravidität abzusetzen. Entsprechendes gilt auch für den Mann, der Azathioprin erhält.
Unter Abwägung von Nutzen für die Mutter und den anscheinend kleinen Risiken für den Feten kann in Einzelfällen von diesem Vorgehen abgewichen werden. Dies gilt insbesondere für eine bereits eingetretene Schwangerschaft.
Stillen unter Azathioprin ist wegen der Gefahr einer Immunsuppression beim Kind nicht erlaubt [7].
Cyclophosphamid
Unter Cyclophosphamid ist mit Amenorrhö und Infertilität zu rechnen.
Einsatz in der Schwangerschaft
Cyclophosphamid ist in der Schwangerschaft wegen Fetotoxizität und Teratogenität kontraindiziert. Das Präparat ist 6 Monate vor der geplanten Schwangerschaft abzusetzen. Tritt unter einer Therapie eine Schwangerschaft ein, besteht eine Indikation zur Interruptio.
Cyclophosphamid ist während der Stillzeit kontraindiziert.
Ciclosporin
Durch Ciclosporin wird die Fertilität nicht sicher beeinflusst.
Einsatz in der Schwangerschaft
Ciclosporin A kann in der Schwangerschaft in der niedrigsten effektiven Dosis fortgeführt werden unter regelmäßigen Kontrollen von Blutdruck und Nierenfunktion.
Im Tierversuch wurde keine Teratogenität nachgewiesen. Über die Sicherheit der Anwendung bei Schwangeren liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Bei nierentransplantierten Schwangeren wurden in 40% eine Wachstumsretardierung und Frühgeburten beschrieben. Es wird auch über vereinzelte Missbildungen bei Neugeborenen, deren Mütter in der Schwangerschaft Ciclosporin erhielen, berichtet [1]. Die Langzeiteffekte auf das Kind, das im Uterus eine entsprechende Exposition erhielt, sind noch völlig unbekannt. Eine eindeutige Empfehlung kann daher nicht gegeben werden.
Stillen unter Ciclosporin ist aufgrund der immunsuppressiven Auswirkungen auf das Kind kontraindiziert [7].
Mycofenolsäure
Mycofenolsäure ist während der Schwangerschaft kontraindiziert. Es sollte 6 Wochen vor Beginn einer Schwangerschaft abgesetzt werden.
Etanercept, Infliximab und Adalimumab
Zum Einfluss von Etanercept und Infliximab auf die Fertilität gibt es keine validen Daten.
Einsatz in der Schwangerschaft
Im Gegensatz zu vielen anderen krankheitsmodifizierenden Medikamenten konnte im Tierversuch keine Teratogenität oder Fetotoxizität nachgewiesen werden. Einzelne Fallberichte zu Frauen, die unter Therapie mit Etanercept oder Infliximab schwanger geworden sind, zeigen keine Hinweise auf eine höhere Komplikations- oder Missbildungsrate. Ausreichende Erfahrungen mit der Therapie während einer Schwangerschaft liegen aber zur Zeit nicht vor.
Bei Frauen muss daher während der Behandlung mit Etanercept und vorsichtshalber bis zu 3 Monaten (Infliximab: bis zu 6 Monaten) nach Therapieende eine sichere Kontrazeption erfolgen. Auch Männer sollten während der Behandlung und bis zu 3 Monate (Infliximab: bis zu 6 Monate) nach Therapieende keine Kinder zeugen.
Für eine unter Therapie eingetretene Schwangerschaft existiert nach heutiger Datenlage keine absolute Indikation zur Interruptio. Bei Wunsch der Betroffenen nach Aufklärung über die zur Zeit unsichere Datenlage kann eine Interruptio aus medizinischer Indikation aber befürwortet werden.
Vom Stillen unter Etanercept, Infliximab und Adalimumab ist aufgrund der bislang nicht bekannten Auswirkungen auf das Kind abzuraten.
Immunadsorption und Plasmapherese
In Ausnahmefällen können bei unzureichender Wirkung von z. B. Steroiden extrakorporale Verfahren in der Schwangerschaft durchgeführt werden.
Immunglobuline
Bei Exazerbationen können auch Immunglobuline in der Schwangerschaft eingesetzt werden [12, 13].
Planung einer Schwangerschaft
Die Behandlungsstrategie hängt davon ab, ob die rheumatische Erkrankung bereits vor der Schwangerschaft bekannt ist. In diesem Fall sollte die Schwangerschaft mit dem behandelnden Arzt geplant werden, um einen möglichst günstigen Zeitpunkt zu wählen. Die Schwangerschaft sollte in eine möglichst inaktive Phase fallen. Bei einer Erkrankung in Remission stellt auch die Schwangerschaft keine Notwendigkeit zur Therapie dar. Eine bereits bestehende Therapie wird auf ihre Notwendigkeit hin überprüft. Wenn es die Krankheitsaktivität erlaubt, können Medikamente gezielt abgesetzt werden. Die Schwangerschaft sollte frühestens nach 3–4 Monaten nach Beendigung der Therapie beginnen, da das Absetzen der Medikamente einen Schub auslösen kann. Falls eine Aktivierung eintritt, ist die Planung einer Schwangerschaft evtl. auch unter einer Therapie (Kortison, Hydroxychloroquin, Azthioprin) möglich.
Tritt ein Schub der Erkrankung auf, sollte zunächst ein Steroidstoß durchgeführt werden. Diese Behandlung unterdrückt die Symptomatik ausreichend gut. Reicht diese Medikation nicht aus, stehen mit Immunglobulinen, Azathioprin und extrakorporalen Verfahren ergänzende Maßnahmen zur Verfügung. In aktiven Phasen von Organbeteiligungen, z. B. einer behandlungspflichtigen Nierenbeteiligung beim SLE, sollte von einer Schwangerschaft abgeraten werden: Es besteht ein zu hohes Risiko für eine Verschlechterung bis hin zur terminalen Niereninsuffizienz. Eine absolute Kontraindikation gegen eine Schwangerschaft stellen schwere Funktionseinschränkungen von Organen und eine zentralnervöse Beteiligung (z. B. ein vorangegangener Insult) beim Antiphospholipidsyndrom dar. Unter Immunsuppression ist die Indikation zur Aminozentese eher großzügig zu stellen, sonographische Untersuchungen an gynäkologischen Zentren zum Ausschluss von Missbildungen werden in der 18.–20. Schwangerschaftswoche empfohlen. Bei Bewegungseinschränkungen im Hüftgelenk oder aktiver Symphysitis bzw. Sakroiliitis sollte der Entbindungsmodus festgelegt werden. Die Schwangerschaft sollte insgesamt als Risikogravidität aufgefasst und ein regelmäßiges immunologisches und gynäkologisches Monitoring in jedem Trimenon der Schwangerschaft sowie post partum durchgeführt werden.
Literatur
1. Antoni CE, Furst D, Manger B et al (2001) Outcome of pregnancy in women receiving Remicade (infliximab) for the treatment of Crohn’s disease or rheumatoid arthritis (abstract) Arthritis Rheum 44(suppl):S 153
2. Brooks PM, Needs CJ (1990) Antirheumatic drugs in pregnancy and lactation. Baillieres Clin Rheumatol 4:157–171
3. Chakravarty EF, Sanchez-Yamamoto D, Bush TM (2003) The use of disease modifying antirheumatic drugs in women with rheumatoid arthritis of childbearing age: a survey of practice patterns and pregnancy outcomes. J Rheumatol 30(2):241–246
4. Davidson JM, Lindheimer MD (1982) Pregnancy in renal transplant recipients. J Reprod Me 27:613–621
5. Derksen RHWM, Bruinse HW, de Groot PG, Kater L (1994) Pregnancy in systemic lupus erythematosus: a prospective study. Lupus 3:149–155
6. Hart CN, Naunton RF (1964) The ototoxicity of chloroquine phosphate. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 80:407–412
7. Jarvis B, Faulds D (1999) Etanercept: a review of its use in rheumatoid arthritis. Drugs 57:945–966
8. Johns DG, Rutherford LD, Leighton PC, Vogel CL (1972) Secretion of methotrexate into human milk. Am J Obstet Gynecol 112:978–980
9. Needs CJ, Brooks PM (1985) Antirheumatic medication in pregnancy. Br J Rheumatol 24:282–290
10. Ostensen M (2006) Antirheumatic therapy and reproduction. The influence on fertility, pregnancy and breast feeding. Z Rheumatol 65:217–224
11. Ostensen M (1994) Optimization of antirheumatic drug treatment in pregnancy. Clin Pharmacokinet 27:486–503
12. Ostensen M (1998) Nonsteroidal anit-inflammatory drugs during pregnancy. Scand J Rheumatol Suppl 107:128–132
13. Ostensen M, Brown ND, Chiang PK, Aarbakke J (1985) Hydroxychloroquine in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 28:357
14. Ostensen M, Skavdal K, Myklebust G, Tomassen Y, Aarbackke J (1986) Excretion of gold into human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 31:251–252
15. Parke A (1992) The role of IVIG in the management of patients with antiphospholipid antibodies and recurrent pregnancy losses. Clin Rev Allergy 10:105–118
16. Parke AL (1998) Intravenous gammaglobulin in pregnancy, the Connecticut experience. Scand J Rheumatol Suppl 107:103–104
17. Parke A, West B (1996) Hydroxychloroquine in pregnant patients with systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 10:1715–1718
18. Roubenoff R, Hoyt J, Petri M et al (1988) Effects of antiinflammatory and immunosuppressive drugs on pregnancy and fertility. Sem Arthr Rheum 18:88–110
19. Slone D, Heinonen OP, Kaufmann DW et al (1976) Aspirin and congenital malformations. Lancet 1373–1375
20. Townsend RJ, Bendetti TJ, Erickson SH, Cengiz C, Gillespie WR, Gschwend J, Albert KS (1984) Exretion of ibuprofen in breast milk. Am J Obstet Gynecol 149:184–186
21. Wolfe MS, Cordero JF (1985) Safety of chloroquine in chemosuppression of malaria during pregnancy. Br Med J 290:1466–1467
Disclaimer:
Als Arzt bin ich rechtlich verpflichtet nur allgemeine Informationen zu geben, die das konkrete und individuelle persönliche ärztliche Gespräch nicht ersetzen können. Insofern kann auch keine Haftung für meine Auskünfte gegeben werden. Nach §7 Abs.3 Berufsordnung der Ärztekammer Berlin, darf die individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere Beratung, nicht ausschließlich über Computerkommunikationsnetze durchgeführt werden.
Erster Ansprechpartner für Ihre medizinischen Belange ist Ihr Arzt, Ihr Kinderwunschzentrum.
Dr. Peet gibt Antworten auf Fragen aus seiner persönlichen Fachkenntnis und seiner persönlichen Einschätzung heraus. Seine Antworten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gelegentlich sind es auschließlich Meinungen und Eindrücke, die sich auf den betreffenden Fall beziehen.
Als Arzt bin ich rechtlich verpflichtet nur allgemeine Informationen zu geben, die das konkrete und individuelle persönliche ärztliche Gespräch nicht ersetzen können. Insofern kann auch keine Haftung für meine Auskünfte gegeben werden. Nach §7 Abs.3 Berufsordnung der Ärztekammer Berlin, darf die individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere Beratung, nicht ausschließlich über Computerkommunikationsnetze durchgeführt werden.
Erster Ansprechpartner für Ihre medizinischen Belange ist Ihr Arzt, Ihr Kinderwunschzentrum.
Dr. Peet gibt Antworten auf Fragen aus seiner persönlichen Fachkenntnis und seiner persönlichen Einschätzung heraus. Seine Antworten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gelegentlich sind es auschließlich Meinungen und Eindrücke, die sich auf den betreffenden Fall beziehen.
Rheuma und künstliche Befruchtung
Hallo Hr. Dr. Peet,
vielen Dank für die ausführliche Recherche.
Was mir leider immer noch nicht klar ist, ob es bei den oben genannten Basismedikamenten
bei der Hormonbehandlung zur Eizellengewinnung vor einer IVF/ICSI zu Wechselwirkungen kommen kann.
Bin mir ziemlich unsicher und die Situation nimmt mich schon lange vor der Behandlung sehr mit.
Viele Grüße
Alfine
vielen Dank für die ausführliche Recherche.
Was mir leider immer noch nicht klar ist, ob es bei den oben genannten Basismedikamenten
bei der Hormonbehandlung zur Eizellengewinnung vor einer IVF/ICSI zu Wechselwirkungen kommen kann.
Bin mir ziemlich unsicher und die Situation nimmt mich schon lange vor der Behandlung sehr mit.
Viele Grüße
Alfine
-
Rabenmutti
- Rang0
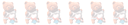
- Beiträge: 74
- Registriert: 09 Apr 2008 08:01
Hallo Alfine
Ich habe die selbe Diagnose und nehme zur Zeit 20 mg Prednisolon und bis ein Spiegel aufgebaut ist gleichzeitig Pleon (Sulfalazin). Ich bin heute T+ 7 und wenn es geklappt hat, werde ich auf jeden Fall das Prednisolon Stück für Stück absetzen, weil die Gefahr einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte bei diesem Medikament erhöht ist - allerdings nicht bei einer so geringen Dosis, wie Du sie bekommst. Mein Rheumatologe hat extra dieses Medikament ausgewählt, weil wir in KiWu-Therapie sind. Zusätzliche Infos über die Medikamente bekommst Du unter:
http://www.embryotox.de/pleon.html
Liebe Grüße
Rabenmutti
Ich habe die selbe Diagnose und nehme zur Zeit 20 mg Prednisolon und bis ein Spiegel aufgebaut ist gleichzeitig Pleon (Sulfalazin). Ich bin heute T+ 7 und wenn es geklappt hat, werde ich auf jeden Fall das Prednisolon Stück für Stück absetzen, weil die Gefahr einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte bei diesem Medikament erhöht ist - allerdings nicht bei einer so geringen Dosis, wie Du sie bekommst. Mein Rheumatologe hat extra dieses Medikament ausgewählt, weil wir in KiWu-Therapie sind. Zusätzliche Infos über die Medikamente bekommst Du unter:
http://www.embryotox.de/pleon.html
Liebe Grüße
Rabenmutti
1. ICSI 05/09: Nullbefruchtung
2. ICSI 07/09: Nullbefruchtung
1. HI 08/09: neg
1. HICSI 11.09: neg
12/09 Warteliste EZS
1. EZS 04/10: neg
06/10 KET FA
09/10 EMS PP: negativ
30.11.10 EMS RF
2. ICSI 07/09: Nullbefruchtung
1. HI 08/09: neg
1. HICSI 11.09: neg
12/09 Warteliste EZS
1. EZS 04/10: neg
06/10 KET FA
09/10 EMS PP: negativ
30.11.10 EMS RF




