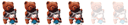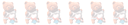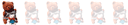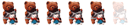Jahrelang wollten sie sehnlichst ein Baby, hofften Monat für Monat vergebens.
Was ein Paar auf sich nahm, bis es endlich eine Familie wurde.
Der lange Weg zum Wunschkind
Au, Jenny, lass das!" Schnaubend wehrt Florian (3 1/2) die tollpat_schigen Annäherungsversuche seiner kleinen Schwester (1 1/2) ~ab. Teils lachend, teils gerührt schaut Andrea Hogrebe (28) ihren zwei Rackern beim Spielen zu. Manchmal kann sie ihr Glück kaum fassen.Jahrelang hatte sie sich Nachwuchs gewünscht - vergebens. Bis ihr die Ärzte endlich helfen konnten, ist Andrea in manches schwarze Loch gefallen: DreiJahre und zwei Monate hat sie gehofft, gebangt, viele Tränen geweint. Allein die Hormonspritzen, die sie sich, um nicht jedes Mal zum Arzt zu müssen, selbst in die Bauchdecke injizierte, füllen einen riesigen Karton: 200 bis 250 werden es gewesen sein. Außerdem musste Andrea Hogrebe mehrmals im Monat zum Blutabnehmen oder zu Ultraschallkontrollen in die Praxis. Zu dieser Zeit war ihr Kinderwunsch so stark, dass sie fast an jeder Ecke Kinderwagen sah. "Schon verrückt", erinnert sie sich, "wie der Wunsch nach einem Baby das Leben prägt. In unserer Familie gibt es viele Kinder. Auch ich wollte endlich eine eigene Familie haben."
Dass Andrea Hogrebe zweifache Mutter ist, verdankt sie der Intra-Cytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI). Das ist ein spezielles Verfahren der künstlichen Befruchtung (siehe S. 50). Bis es damit klappte, musste das Paar einiges auf sich nehmen...
Rückblende: 1994 heiraten Andrea und Matthias Hogrebe. Die damals 19-Jährige macht gerade eine Umschulung zur Bürokauffrau. Danach würde ein Kind gut passen. Andrea Hogrebe lässt die Pille weg, doch sie wird nicht schwanger. ZweiJahre lang hofft sie von Zyklus zuZyklus, wird immer unruhiger. Schließlich schickt ihr Frauenarzt sie zu seiner neuen Kollegin, die eine Kinderwunschsprechstunde anbietet. Sie rät ihrer Patientin, zunächst einen Zyklus lang Temperatur zu messen, um zu prüfen, ob es zum Eisprung kommt. Das Ergebnis ist positiv. Als nächstes untersucht die Ärztin Matthias Hogrebe (heute 33). Dabei stellt sie fest: Seine Spermien sind gesund, aber zahlenmäßig an der unteren Grenze.
Nun wird Andreas Zyklus hormonell stimuliert, damit im Eierstock mehr Eizellen heranreifen und größer werden. Dazu spritzt sich Andrea jeden Tag Hormone. Es ist unangenehm, sich selbst in den Bauch zu pieksen. Um den Eisprung herum fühlt er sich aufgebläht an und schmerzt. Und das Liebesleben hat jetzt einen Fahrplan. "Doch das nimmt man alles gern auf sich, wenn es nur endlich klappt", sagt Andrea. Zwei, drei Mal sieht es so aus, doch dann setzen die Blutungen mit Verspätung ein. Die junge Frau verlässt der Mut, sie will sich die Spritze nicht mehr setzen. In dieser Zeit zeigt sich, wie gut ihre Partnerschaft ist. Matthias leidet mit, baut sie immer wieder auf. "Wenn du nicht spritzt, dann mach ich das", spricht er ihr Mut zu. Trotzdem fällt sie mit jeder Monatsblutung in ein schwarzes Loch. "Erst die Hoffnung, dann wieder der Frust - auf Dauer ist das nur schwer auszuhalten."
Das ändert sich erst, als die Frauenärztin vorschlägt, es mit einer Insemination zu versuchen (siehe S. 50). Vorher will sie nachsehen, ob die Eileiter gut durchgängig sind. Die Bauchspiegelung zeigt: Die Eileiter sind durch Entzuiidungen verklebt, zudem ist einer mit der Blinddarmnarbe verwachsen. Die Chance, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, liegt höchstens bei einem Prozent (normal sind 25 Prozent pro Zyklus). Ein herber Schlag: EinJahr lang umsonst Hor
mone gespritzt, insgesamt wartet Andrea Hogrebe bereits dreiJahre auf ein Kind. Trotzdem fühlt sie sich besser als vorher. "Ich hatte jetzt Klarheit und wusste, wie es weitergeht."
Noch eine Hürde
Das Paar entscheidet sich für IVF, für die Befruchtung im Reagenzglas. Eine Untersuchung beim Spezialisten zeigt jedoch, dass Matthias Hogrebe noch weniger Samenzellen hat als vorher, dass sie schlechter beweglich und teilweise auch deformiert sind. Vermutlich eine Altlast vom Schrottplatz, auf dem er früher einmal gearbeitet hat. Der Arzt spricht nüchtern von "kleinen Hoden" und "grenzwertigem Sperma". Doch für Matthias heißt das so viel wie: "Du bist nur ein halber Mann oder impotent". Nach dieser Untersuchung rät der Spezialist zu ICSI. Diese Methode wirdDeutschland mittlerweile fast ebenso oft angewandt wie IVF. Das Verfahren ist ähnlich, bei ICSI wird allerdings nur eine Samenzelle direkt in das Ei gespritzt. ICSI ist umstritten. Immer wieder heißt es, ICSI-Kinder wie sen überproportional häufig Missbildungen auf. Studie steht gegen Studie, die Befruchtungsexperten nehmen die Bedenken allerdings ernst. Die junge Berlinerin nahm das in Kauf. "Die Methode wird inzwischen so häufig angewandt, dass ich keine Sorge hatte", sagt sie. Ihren Mann beschäftigte vor allem, dass die Chance, ein Baby zu kriegen, auch mit ICSI sehr gering ist. Sie beträgt pro Zyklus zwischen 15 und 25 Prozent. Matthias: "Ich wusste, ich komme damit zurecht, wenn wir keine Kinder haben werden. Ich sorgte mich um meine Frau. Die Vorstellung, wie es ihr ergehen würde, wenn es nicht klappt, war furchtbar. Ich hatte Angst, dass ich sie dann nicht trösten kann.
Am Tag X, nach dem Schwangerschaftstest, sitzt Andrea zwei Stunden vor dem Telefon und traut sich nicht, in der Praxis anzurufen. Als sie endlich zum Hörer greift, ist die lapidare Antwort der Sprechstundenhilfe: "Ihr Befund ist positiv." Andrea ist endlich schwanger! Die Behandlung war gleich beim ersten Zyklus erfolgreich. Das ist sehr selten, manche Paare brechen nach vier, fünf vergeblichen Versuchen ab.
Andrea Hogrebe weiß, welches Glück sie hatte und welch starken Rückhalt in ihrem Mann, ihrer Frauenärztin und ihrer Familie. "Viele sparen das Thema eher aus, um einen damit nicht zu belasten. Dabei ist es so wichtig, dass man darüber sprechen kann", sagt sie. Am 16. November 1999 bringt sie Sohn Florian zur Welt. EinJahr später gehen die Eltern wieder in die Kinderwunschsprechstunde, wieder hat Andrea Glück und wird auf Anhieb schwanger: Mit der Geburt ihrer TochterJennifer am 14. Februar 2002 wird ihr Kinderwunsch zum zweiten Mal erfüllt. Die Hogrebes sind heute ein glückliches Kleeblatt.
---
Die Sozialpädagogin Barbara Lamprecht arbeitet beim Sozialdienst katholischer Frauen e.V. in Augsburg
Das ist kein Spaziergang!
Wer eine Kinderwunschbehandlung beginnt, sollte sich iiber die Folgen im Klaren sein. Dazu sprachen wir mit Barbara Lamprecht, einer der Leiterinnen der Katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Augsburg
Was kommt auf die Paare zu?
Die Behandlung kann körperlich und seelisch belastend sein, je nachdem, wie weit man geht. Es wird Höhen und Tiefen geben, die jemand auffangen muss. Und es kommen viele Arzitermine auf einen zu, vor allem auf die Frau. Die Sexualität verändert sich. Wer Liebe nach Stundenplan machen muss, verliert oft die Lust.
Eine Prüfung für die Paare?
Das hängt ganz von dem Paar ab. Für manche ist es eine Chance, schweißt sie enger zusammen. Das zeigen auch die Scheidungsraten. Sie sind bei Kinderwunsch-Paaren deutlich niedriger als bei denen, die auf normalem Wege Kinder bekommen. Es kann aber auch zur Krise kommen: Unerledigte Konflikte tauchen wieder auf und belasten das Paar. Schwierig ist auch, wenn die beiden nicht genug über ihre Wünsche und Sorgen reden. Männer können das oft nicht so gut wie Frauen. Sie suchen sich ein anderes Ventil, gehen beispielsweise in die Garage und schrauben am Motorrad herum. Und ihre Partnerin fübit sich allein gelassen - Stoff für Zoff.
Wissen die Paare eigentlich, auf was sie sich einlassen?
Manches kann man vorher einfach nicht absehen. Aber in der Regel sind die Frauen, die zu uns kommen, sehr gut informiert.
Wo können sie sich Hilfe holen ind dieser schweren Zeit?
Wichtig ist, jemanden zum Reden und Zuhören zu haben. Das kann eine gute Freundin sein oder eine Selbsthilfegruppe. Wir bieten außerdem Einzel- und Paarberatung sowie Gesprächskreise für Betroffene an. Der Austausch tut gut und kann auch Anstöße geben für Alternativen wie etwa eine Adoption.
Was würden Sie den Paaren noch raten?
Uberlegen Sie gut, wie weit sie gehen. Man muss nicht alles, was medizinisch möglich ist, auch um jeden Preis machen. Und lassen Sie sich Zeit bei der Wahl des Arztes. Es gibt große Unterschiede, weniger in der medizinischen Qualität, die ist in Deutschland sehr gut. Es geht mehr darum, ob man sich menschlich gut aufgeboben fühlt und dass man nicht in einer großen, unpersönlichen Maschinerie landet. Paare Anfang Dreißig sollten außerdem rechtzeitig abklären lassen, weiche körperlichen Ursachen ihre Kinderlosigkeit hat und sich nicht vertrösten lassen nach dem Motto "Das wird schon noch" sonst läuft ihnen die Zeit davon. Und sie sollten versuchen, die gemeinsame Zeit wieder bewusst zu genießen und ihr Leben nicht vom Kinderwunsch dominieren zu lassen.
Was sehen Sie für die Zukunft?
Es ist ja geplant, dass die Krankenkassen die Behandlung nicht mehr zahlen. Dann werden viele Paare überlegen, ob sie ins Ausland gehen, wo medizinisch mehr erlaubt ist. Eizellspenden, Leihmutterschaft, Präimplantationsdiagnostik und mehr. Ich fürchte, das leistet manchen Auswüchsen Vorschub. Das wäre sehr bedauerlich.
So kann es die Natur
Jedes sechste Paar in Deutschland wartetvergeblich auf ein Baby. Was man selbst tun kann, um schneiler zum Wunschkind zu kommen:
Gesund essen
Falsche Ernährung kann eine Schwangerschaft verhindern, fand Prof. Ingrid Gerhard von der Heidelberger Universitäts-FrauenUlinik heraus. Sie rät deshalb zunächst zu einer Emehrungsamstellung! um den Zyklus zu normalisieren. Mehr Tipps, wie Paare ihre Fruchtbarkeit selbst beeinflussen können, finden Sie in dem Ratgeber "Kinderwunsch. Neue Weg, zum Wunschkind", Gräfe und Unzer, 15,90 Euro.
Aufs Rauchen verzichten
...fillt nicht leicht, ist aber notwendig. Denn Nikotinkonsum schadet der Fruchtbarkeit - sowohl bei der Frau wie beim Mann.
Zum Zahnarzt gehen
Keime in der Mundhöhle oder in Zahnfleischtaschen sind gelegentlich schuld an ungewollter Kinderlosigkeit
Sich entspannen
Stress fördert die Produktion von Adrenalin, das wiederum mindert die Fruchtbarkeit. Noch ein Grund um Stress abzubauen: Lustvoiler, entspannter Sex stimuliert auch die Sexualhormone und verbessert die Qualitat der Spermien.
Reden, reden, reden
Eine Gruppe amerikanischer Frauen traf sich regelmäßig, um über ihren Kinderwunsch zu reden. Nach einem Jahr war die Hälfte schwanger! Selbsthilfegruppen:
www.wunschkind.de
Das kann die Medizin
Die moderne Medin bietet folgende Möglichkeiten der Behandiung:
Hormonstimulation:
Mit Tabletten oder Spritzen wird der Zyklus der Frau angeregt. Mehr Eizellen reifen heran und die Gebärmutter wird gut auf das Einnisten des befruchteten Eis vorbereitet.
Insemination:
Der Arzt führt aufbereitete Spermien des Mannes mithilfe eines Schlauchs direkt in die Gebärmutter ein.
In vitro Fertilisation (IVF):
künstliche Befruchtung im Labor. Die Frau wird hormonell stim uliert, dann entnimmt ihr der Arzt unter Kurzzeitnarkose Eizellen. Sie werden in einer Schale mit aufbereiteten Spermien des Mannes zusammengebracht. Nach zwei, drei Tagen im Brutschrank setzt der Arzt der Frau zwei oder drei befruchtete Eizellen ein.
Intra-Cytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI):
wie IVF, nur wird dazu eine Samenzelle des Mannes direkt in eine Eizelle der Frau injiziert.
Das zahlen die Kassen
Werden die Pläne der Bundesgesundheitsministerin Gesetz, müssen künftig alle Paare die Behandlungen zur künstlichen Befruchtung selbst zahlen. Das macht schnell ein paar tausend Euro aus! Bislang übemehmen die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel folgende Leistungen:
8 Inseminationsversurche in normalen oder optimierten Zyklen
6 Inseminationsversuche im stimulierten Zyklus
4 IVF- und / oder ICSI-Zyklen; bei ICSI muss bereits bei den ersten beiden Versuchen eine Schwangerschaft eingetreten sein.
Die Leistungen sind :an: bestimmte Voraussetzungen gebunden, die Partner müssen etwa verheiratet sein und einen HlV-Test vorlegen. Auch wenn ein Partner gesetzlich, der andere privat versichert ist, klärt man am besten rechtzeitig, welche Kasse die Kosten übernimmt.
Noch mehr Infos finden Sie
... im Internet auf der Homepage des Frauenarztes Elmar Breitbach. Dort gibt's auch ein Forum, in dem sich Betroffene austauschen:
www.wunschkinder.de
Frauen und Paare können sich beim Sozialdienst katholischer Frauen (Adressen im Telefonbuch) kostenlos beraten lassen. Dort gibt es auch Gesprächskreise.
Wer eine Behandlung beginnt, sollte folgende Frage für sich klären: "Wie weit gehen wir für ein Kins'" Das gleichnamige Buch von ZEIT-Redakteur Martin Spiewak kann dabei helfen. Es ist profunde recherchiert, gut zu lesen und zeigt auch die negativen Seiten der Reproduktionsmedizin auf (Eichborn, 22,90 Euro).