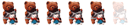Das unten stehende bzw. anhängende Schreiben von einer Arbeitsgruppe von DI-Familie.de habe ich am 3.7. der Bundeskanzlerin überreicht:
Betroffene Eltern sehen gesetzgeberischen Handlungsbedarf:
Auch Deutschland braucht eine zentrale Dokumentationsstelle für „Donogene Insemination“
Paare, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können, müssen in unserer Gesellschaft verschiedene Hürden überwinden: Eine der ersten Hürden, die sie überwinden müssen, ist die finanzielle Belastung einer reproduktionsmedizinischen Behandlung. Daran scheitern bereits viele Anläufe. Unter der Rubrik „Wie wollen wir zusammenleben? Wie können wir kinderreicher und familienfreundlicher leben? Wie können Staat und Gesellschaft für mehr Sicherheit sorgen...“ soll nun im Rahmen des „Zukunftsdialogs über Deutschland“ mit der Bundeskanzlerin persönlich diskutiert werden, wie die Erfüllung eines Kinderwunsches finanzierbarer gemacht werden kann.
Natürlich hören aber die Probleme der Eltern mit der assistierten Reproduktion nach einer geglückten Finanzierung und nach der geglückten Geburt eines Kindes nicht auf. So z.B. im Fall der „Donogenen Insemination“, der Spendersamenbehandlung, eine der vielen Behandlungsmethoden der Reproduktionsmedizin. Wenn sich Paare für den Weg der Spendersamenbehandlung entschieden haben, stoßen sie auf weitere Hürden: Wie alle Eltern wollen sie den eigenen Kindern keine künftigen Bürden auflasten. Und weil sie weit in die Zukunft ihrer Kinder denken, wissen sie, dass es absehbar ist, dass das Kind irgendwann auf wesentliche Fragen zu seiner Person stoßen wird, zum Beispiel seiner Entstehung und den Umständen seiner Zeugung. Viele Eltern werden mit ihren Kindern über die Tatsache der Spenderbehandlung offen sprechen. Und sie brauchen dafür die Sicherheit, dass ihr heranwachsendes Kind Antworten bekommen kann. Zwar steht in der frühen Entwicklungsphase von Kindern der Beziehungs- und Bindungsaufbau zu den unmittelbaren Bezugspersonen im Vordergrund; die Anonymität des Samenspenders stellt dann kein Problem dar sondern schützt in der Regel das Familiensystem. Spätestens aber in der Phase von Ablösung und Identitätsfindung kann die Frage der biologisch-genetischen Abstammung eine größere Bedeutsamkeit für das Kind bekommen. Wer der Spender ist, kann dann eine drängende, ja quälende Frage für Menschen werden, die mithilfe der donogenen Insemination gezeugt wurden. An dieser Stelle wollen sich viele Eltern dafür engagieren, dass das erwachsen werdende Kind sein Persönlichkeitsrecht auf Wissen um die eigene Abstammung tatsächlich geltend machen kann. Wenn man aus einer Spendersamenbehandlung entstanden ist, muss man die Gewähr haben, bei Nachforschung die Identität des Spenders erfahren zu können, sobald man an den Punkt gelangt, dies für die persönliche Entwicklung zu brauchen.
Es sind Strukturen nötig, die für donogen gezeugte Menschen zuverlässig sicherstellen, dass sie Wissen über die eigene Abstammung erlangen können. Es liegt in der Verantwortung der Politik, eine gesetzlich klar definierte Struktur anzubieten, die Informationen für die sogenannten „Spenderkinder“ zugänglich macht, ohne dass die Betroffenen als Bittsteller bei Samenbanken oder behandelnden Ärzten auftreten müssen und ohne dass sie Gefahr laufen, dass diese Informationen über die Jahre bei den Behandlern verloren gehen. Ein nationales Register könnte hierfür eine Gewähr bieten.
Trotz Embryonenschutzgesetz, trotz Kindschaftsrechtsverbesserungsgesetz, trotz Transplantationsgesetz und Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung und trotz entsprechender Berufsordnungen und Leitlinien gibt die aktuelle Gesetzeslage keine näheren Hinweise auf genauere Ausführungs-bestimmungen und Zugangsregeln zu entsprechenden Daten. Es bleibt unklar, wie ein erwachsenes Kind, das durch Spendersamenbehandlung entstanden ist, mit Sicherheit auf die von ihm gewünschte Information der Spenderdaten zugreifen kann. Es bleibt vage, wie das Auskunftsrecht des Kindes faktisch umgesetzt werden kann und wie wirksam verhindert werden kann, dass Reproduktionsmediziner die Spenderdaten nach oder noch innerhalb der Aufbewahrungsfristen straffrei vernichten können. Die Haltung einzelner Samenbankbetreiber bezüglich der Herausgabe der Spenderdaten scheint momentan von Fall zu Fall unterschiedlich zu sein. Auch zukünftig ist im schlimmsten Fall denkbar, dass es für das Kind faktisch unmöglich bleiben wird, die Spenderidentität zu erfahren, wenn es danach verlangt. Und das, obwohl die Aufbewahrungsfrist auf 30 Jahre verlängert worden ist.
So melden sich erwachsene „Spenderkinder“ nun auch in Deutschland mehr und mehr via Medien und Internet zu Wort, weil sie ihre Spenderdaten nicht in Erfahrung bringen können. Dieser Trend wird sich in Zukunft bestimmt zu einem größeren Medienspektakel ausweiten, wenn die Politik hier nicht aktiv wird.
Aus Sicht besorgter Eltern gilt es daher für den reproduktionsmedizinischen Bereich der Donogenen Insemination endlich eine unabhängige staatliche Dokumentations-stelle der Spenderdaten einzurichten – selbstverständlich unter der Bedingung, dass die Schutzinteressen des Samenspenders gewahrt sind: es muss eine generelle Freistellung des Spenders geben von juristischen Elternpflichten und -rechten, das heißt gegen die Inanspruchnahme durch das Kind.
Bei einem Blick in die gängige Fachliteratur wird der Aufbau eines Registers von Fachexperten quer durch alle beteiligten Statusgruppen befürwortet. Führende Reproduktionsmediziner, Juristen, psychosoziale Berater, „Spenderkinder“ – sie alle haben sich bereits für ein zentrales Spenderregister ausgesprochen. Eine aktuelle schriftliche Umfrage des Elternnetzwerkes di-familie.de bei den deutschen Samenbankbetreibern scheint ebenfalls diese einhellige Tendenz zu einem solchen Zentralregister zu bestätigen.
Ein solches Register mit Meldepflicht der Reproduktionsmediziner sollte nicht privaten Initiativen oder dem ärztlichen Regime überlassen bleiben. Es sollte elternunabhängig, arztunabhängig, also unabhängig von bisherigen Akteuren, in staatliche Hände genommen werden, damit Kinder eine verlässliche Anlaufstelle vorfinden, die ihnen die Option einer sicheren, lebenslangen Auskunftsmöglichkeit garantiert. Bei der Entwicklung eines nationalen Registers sollten Vertreter aus der Praxis unbedingt beteiligt sein. Vielleicht im Rahmen eines Sachverständigen-gremiums aus Experten der verschiedenen Interessengruppen. Das heißt konkret Reproduktionsmediziner vom Arbeitskreis Donogene Insemination AKDI, sachkundige Juristen (Müller, Wehrstedt, Helms etc.), Ethiker (Fischer, Wiesemann) psychosoziale Berater der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung BKID wie Thorn und Wischmann, Mitarbeiter des Deutschen-IVF-Registers DIR, Vertreter von Elternnetzwerken wie DI-Familie und IDI, aber auch erwachsene, durch Fremdsamenspende gezeugte Menschen, zum Beispiel aus dem Verein von Spenderkinder.de. Diese Expertengruppe könnte gemeinsam mit Fachleuten der Datenverwaltung weitere Einzelheiten klären. Zum Beispiel, ob das Register Zwecke erfüllen soll wie die statistische Erfassung der Spendersamenbehandlung. Eine statistische Erfassung ist hilfreich, wenn wir eine inflationäre Anzahl möglicher Kinder pro Fremdspender und damit u.a. die wenngleich minimale Inzestgefahr für Spenderkinder begrenzen wollen. Die Dokumentationsstelle könnte Qualitäts-sicherungsmaßnahmen, Kontroll- und Überwachungsaufgaben, Moderatorenfunktion und die Koordination psychosozialer Dienste übernehmen und Expertise sammeln.
In anderen europäischen Staaten hat sich die Einrichtung eines behördlichen Registers für Samenspender nicht umsonst durchgesetzt und als bewährter Schritt herausgestellt: in der Schweiz, Österreich, Schweden und vor allem in England, darüber hinaus in Australien und in Neuseeland. Man hat überall gute Erfahrung mit dieser Registrierung gemacht, denn eine zentrale Dokumentation bietet allen Beteiligten am meisten Rechtssicherheit und einen pragmatischen Umgang mit Auskunftsfragen. Es ist Zeit, dass Deutschland hier nachzieht, auch im Namen der Harmonisierung der europäischen Rechtssituation.
Die Anonymität von Spendern kann nur eine zeitlich befristete sein! Wenn Deutschland die Donogene Insemination erlaubt und die Zulässigkeit dieses Behandlungsverfahrens heute nicht mehr infrage steht, dann haben Eltern ein großes Interesse, dass der deutsche Staat noch mehr Verantwortung übernimmt und Sicherstellungsleistungen für das Auskunftsrecht der so gezeugten Kinder in Gang bringt. Mit der Finanzierung von Kinderwunschbehandlung wird Deutschland vielleicht kinderreicher, erst mit der rechtlichen Absicherung der jeweiligen Behandlungsmethode wird es familienfreundlicher.
Dieser Text wurde von der Arbeitsgruppe „Spenderregister“ aus dem Elternnetzwerk di-familie.de verfasst.
Kontakt über: www.di-familie.de
Literatur:
AKDI (1996) Behandlungsgrundsätze der Donogenen Insemination (S. 4)
AKDI (2006) Richtlinien des Arbeitskreises für Donogene Insemination zur Qualitätssicherung der Behandlung mit Spendersamen in Deutschland. 8.2.2006, (S. 34)
Arndt, D.; Obe, G. (Hg) (2000) Fortpflanzungsmedizin in Deutschland. Wissenschaftliches Symposium des Bundesministeriums für Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut vom 24.- bis 26. Mai 2000 in Berlin. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit. Band 132. (S. 108)
Bispink, G. (2010) Reproduktionsmedizinische Aspekte. In: Duttge.G.; Engel, W.; Lipp,V.; Zoll, B. (Hg.) Heterologe Insemination – aktuelle Lage und Reformbedarf aus interdisziplinärer Perspektive. 1-8, 64-65, 69 (S.6, 64, 69)
BKID (2009) Offener Brief bezüglich der Finanzierung von Kinderwunschbehandlungen und ihrer gesetzlichen Neuregelung. Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie. 6 (3), 145-146 (S. 146)
Bund-Länder-Arbeitsgruppe (1988) Abschlußbericht „Fortpflanzungsmedizingesetz“ Rohentwurf für ein Gesetz zur Regelung der künstlichen Befruchtung beim Menschen.
Bockenheimer-Lucius, G.; Thorn, P. (2002) Anonymität und Identität – Ethische Probleme um das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner genetischen und sozialen Herkunft. Vortrag Wiesemann, C.; Meier, C. Das Kind als Patient. Ethische Konflikte zwischen Autonomie und Fürsorge. Tagung in 2.-4.10.2002, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Coester-Waltjen, D. (1986) Die künstliche Befruchtung beim Menschen. Gutachten für den 56. Deutschen Juristentag. In: Ständige Deputation des deutschen Juristentages (Hg.) Verhandlungen des Sechsundfünzigsten Deutschen Juristentages Berlin 1986.
Coester-Waltjen, D. (2002) Gesetzgebung in der Fortpflanzungsmedizin – die Lage in der Bundesrepublik Deutschland. Deutsch-Französische Juristentagung, Jahrestagung am 21. September 2002 auf Frauenchiemsee (S. 12)
Crawshaw, M. (2011) Report on Trip to Australia and New Zealand July-September 2010 to study Donor Register and Donor Linking Services.
Diedrich, K., Felderbaum, R.; Griesinger, G.; Hepp, H.; Kreß, H. Riedel, U. (2008) Reproduktion im internationalen Vergleich. Wissenschaftlicher Sachstand, medizinische Versorgung und gesetzlicher Regelungsbedarf. Gutachten im Auftrag der Friedrich Ebert Stiftung. (S. 9
Duttge, G., Engel, W.; Lipp, V.; Zoll, B. (2010) In: dies (Hg.) Heterologe Insemination, Aktuelle Lage und Reformbedarf aus interdisziplinärer Perspektive. Empfehlungen. S. 73-75 (S. 74)
Fischer, T. (2011) Ethische Aspekte der Donogenen Insemination. Dissertation Medizinische Fakultät TU Aachen. (S. 52, 124, 131)
Frommel, M.; Taupitz, J., Ochsner, A.; Geisthövel, F. (2010) Rechtslage der Reproduktionsmedizin in Deutschland. Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie 2010; 7 (2), S. 96-105. (S. 105)
Helms, T. (2010a) Die künstliche Befruchtung aus familienrechtlicher Sicht: Probleme und Perspektiven. In: S. Röthel, A.; Löhnig, M.; Helms, T. Ehe, Familie, Abstammung - Blicke in die Zukunft. S. 49-70 (S. 63)
Helms, T. (2010b) Familienrechtliche Grundlagen. In: Duttge.G.; Engel, W.; Lipp,V.; Zoll, B. (Hg.) Heterologe Insemination – aktuelle Lage und Reformbedarf aus interdisziplinärer Perspektive. 37-50 (S. 45)
Katzorke, H. (2008) Entstehung und Entwicklung der Spendersamenbehandlung in Deutschland , In: Bockenheimer-Lucius, G.; Thorn, P., Wendehorst, C. (Hg.) Umwege zum eigenen Kind. Ethische und rechtliche Herausforderungen an die Reproduktionsmedizin 30 Jahre nach Louise Brown. 89- 102. (S.99)
Keiper, U. ; Kentenich, H. (2007) Die Verwendung von fremden Samen im Rahmen der Reproduktionsmedizin. Auswirkungen der (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion 2006 der Bundesärztekammer. Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie. 1, S. 34 – 37. (S. 36)
Koch, H.-G. (2001) Fortpflanzungsmedizin im europäischen Rechtsvergleich. Aus Politik und Zeitgeschichte. B 27/2001, Bundeszentrale für politische Bildung. S. 44-53 (S.46)
Müller, H. (2012) Auskunftsrecht des Kindes bei Donogener Insemination. Vortrag Tagung Di-Familie, Bad Neuenahr. Unveröff.
Naumann, D. (1999) Vereitelung des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung bei künstlicher Insemination. ZRP, Heft 4. S. 142- 144. (S. 143)
Revermann, C.; Hüsing, B. (2010) Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) gemäß § 56a der Geschäftsordnung. Fortpflanzungsmedizin – Rahmenbedingungen, wissenschaftlich-technische Entwicklungen und Folgen. Deutscher Bundestag 17/3759 (S. 122)
Ratzel; R. (2010) Beschränkung des Rechts auf Fortpflanzung durch das ärztliche Berufsrecht In: Frister, H.; Olzen, D. (Hg.) Reproduktionsmedizin: Rechtliche Fragestellungen. S. 43-58. (S. 53)
Schreiber, G. ; Simon, D.V. (2004a) Medizinische und rechtliche Aspekte der Samenspende. MMW-Forschr. Med. Nr 44 (146Jg), 889- 891. (S. 891)
Schreiber, G. ; Simon D.V. (2004b) Medizinische und rechtliche Aspekte der donogenen (heterologen) Insemination in Deutschland. Ärzteblatt Thüringen. 14. S. 550- 553. (S. 553)
Schumacher, K. (1987) Fortpflanzungsrecht und Zivilrecht. ZFamR, S. 313 -324. (S. 320-321)
Spenderkinder.de (2012) Webseite. Politische Forderungen
Taupitz, J. (2000) Die Verantwortung des parlamentarischen Gesetzgebers für Sicherheit, Qualität, Dokumentation und Patientenaufklärung bei medizinisch unterstützter Fortpflanzung sowie für die Einführung neuartiger Verfahren. In: Arndt, D.; Obe, G. (Hg.) Fortpflanzungsmedizin in Deutschland. Wissenschaftliches Symposium des Bundesministeriums für Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut vom 24.- bis 26. Mai 2000 in Berlin. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit. Band 132 S. 280-292 (S. 286)
Thorn, P., Wischmann, T. (2008) Eine kritische Würdigung der Novellierung der (Muster-) Richtlinie der Bundesärztekammer 2006 aus der Perspektive der psychosozialen Beratung. Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie. 1. S. 39-44 (S. 41)
Thorn, P. (2011a) Donogene Insemination – psychosoziale und juristische Dimensionen. Expertise im Rahmen des Projekts „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland – Fallzahlen, Angebote, Kontexte.“ Deutsches Jungendinsitut. Gefördert durch das BMfFSF. (S. 41)
Thorn, P (2011b) Interview. In: Arp, D. Seelennot nach Samenspende? Wenn Leben im Labor beginnt. Leonardo – Wissenschaft und mehr. WDR 31.8.11.
Thorn, P.; Daniels, K. (2000) Die Praxis der donogenen Insemination in Deutschland. In: Geburtshilfe und Frauenheilkunde. Jg. 60, S. 630-637.
Von Sethe, H. (1995) Die Durchsetzbarkeit des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung aus der Sicht des Kindes. (S. 241-243)
Wehrstedt, S. (2005) Anfechtungsrechte im Falle heterologer Insemination – Anmerkungen zum Urt. Des BGH v. 26.1.2005 – XII ZR 70/03. DNotZ 2005, 649-655.
Wehrstedt, S. (2010) Gutachten: Konzeption eines Auskunftsverfahrens bei Anfrage eines Kindes, welches durch eine heterologe Insemination gezeugt wurde, nach der Identität des Samenspenders.
Wellenhofer, M. (2010) In: Schwab, Dieter; Maurer, Hans-Ulrich; Olzen, Dirk et al Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 8: Familienrecht II ($$ 1589-1921), SGB VIII. (S. 142.)
Wendehorst, C. (2008) Die rechtliche Regelung der ART in Deutschland und Österreich. In: Bockenheimer-Lucius, G.; Thorn, P., Wendehorst, C. (Hg.) Umwege zum eigenen Kind. Ethische und rechtliche Herausforderungen an die Reproduktionsmedizin 30 Jahre nach Louise Brown. 103- 121. (S. 120)
Wiesemann, C. (2006) Von der Verantwortung ein Kind zu bekommen. Eine Ethik der Elternschaft.
Zumstein, M. (2001) Keimzellspende - Juristische Thesen In: Fortpflanzungsmedizingesetz. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit. S. 134- 142, (S. 134)
Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Forderung nach einem zentralen Spenderregister
Die heterologe Insemination ist eine Insemination mit Spendersamen.
Hinweis: offen zugänglich.
Hinweis: offen zugänglich.
Moderatoren: rebella67, Moderator-HI
Forderung nach einem zentralen Spenderregister
- Dateianhänge
-
- Spenderregister - Forderung von di-familie.de 28.6.12.doc
- (41 KiB) 367-mal heruntergeladen
Liebe Grüße, Rebella
------------------------------------------
------------------------------------------
Zurück zu „Informationen rund um das Thema HI“
Gehe zu
- Allgemeines
- ↳ Ich bin neu hier
- ↳ Treffen, Aktionen & Veranstaltungen
- ↳ Presse, Medien, Seminare/Webinare
- ↳ Kinderwunsch-Kliniken
- Forum intern
- ↳ Forums-Technik, Bedienung & Unterstützung
- Medizinischer bzw. betreuter Bereich
- ↳ Fragen an den Repromediziner
- ↳ Fragen an Dr. Peet rund um die Eizellspende - Barcelona - Instituto Marquès
- ↳ Fragen an die Biologin
- ↳ Fragen an die Kinderwunschklinik Barcelona IVF
- ↳ Fragen an die Klinik ivf-spain Madrid
- ↳ EggDonationFriends - Webinare und Infos
- ↳ Eizellspende-Seminare
- ↳ Fragen an die Pädagogin
- ↳ Fragen an den Homöopathen
- ↳ Fragen an den Andrologen
- ↳ Kostenerstattung GKV und PKV bei klein-putz
- Theorie
- ↳ Akupunktur und Naturheilverfahren
- ↳ Schilddrüse
- ↳ Forschungsergebnisse zur Reproduktionsmedizin
- ↳ Immunologisches / Blutwerte
- Kinderwunsch
- ↳ Fragen und Antworten für Neueinsteiger
- ↳ Rund um den Kinderwunsch
- ↳ Medikamente beim KiWu
- ↳ Erfahrungen und Tipps im Kiwu-Zyklus
- ↳ Ursachen: PCO
- ↳ Ursachen: männliche Infertilität
- ↳ Kostendiskussion
- ↳ Gesundheitsreform und Versorgungsstrukturgesetz
- ↳ Embryonenschutzgesetz
- ↳ Abschied vom Kinderwunsch
- ↳ Sternenkinder
- KiWu-Praxen - für Einsteiger und Wechsler
- ↳ Praxis- und Zentrumsvorstellung
- ↳ Allgemeines
- ↳ Ausland
- ↳ Baden-Württemberg
- ↳ Bayern
- ↳ Berlin
- ↳ Brandenburg
- ↳ Bremen
- ↳ Hamburg
- ↳ Hessen
- ↳ Mecklenburg-Vorpommern
- ↳ Niedersachsen
- ↳ Nordrhein-Westfalen
- ↳ Rheinland-Pfalz
- ↳ Saarland
- ↳ Sachsen
- ↳ Sachsen-Anhalt
- ↳ Schleswig-Holstein
- ↳ Thüringen
- Geschützter Bereich
- ↳ Medikamentenabgabe und -tausch
- ↳ Adoption im In- und Ausland, Pflegekinder
- ↳ Eizellspende
- ↳ Embryonenspende
- ↳ Austausch mit Eizell-/Embryonenspenderinnen/Samenspendern und Leihmutterschaft
- ↳ Kiwu und Translokation
- ↳ Kiwu bei Paaren mit Infektionskrankheiten
- ↳ Krankheiten, Entwicklungsstörungen, Fehlbildungen
- ↳ Psychische Probleme
- ↳ Schwierige Kinder
- Heterologe Insemination
- ↳ Informationen rund um das Thema HI
- ↳ HI - persönlicher Erfahrungsaustausch (geschützt)
- Aufklärung Adoption, Eizellenspende, Heterologe Insemination, Embryonenspende
- ↳ Informationen rund um das Thema Aufklärung
- ↳ Aufklärung Ado, EZS, HI, EmbS - persönlicher Austausch (geschützt)
- (Fast) geschafft...
- ↳ Fragen/Antworten für Neuschwangere
- ↳ Schwanger...
- ↳ Geburtsanzeigen
- ↳ Mamis & Papis
- ↳ Bauen und Renovieren mit Kindern
- ↳ Stillen
- ↳ Tagesmütter und Babysitter
- ↳ Babymenüs
- ↳ Babysachen-Tipps
- ↳ Arbeitsrecht
- Klinikführer
- ↳ Allgemeines
- ↳ Ausland
- ↳ Baden-Württemberg
- ↳ Bayern
- ↳ Berlin
- ↳ Brandenburg
- ↳ Bremen
- ↳ Hamburg
- ↳ Hessen
- ↳ Mecklenburg-Vorpommern
- ↳ Niedersachsen
- ↳ Nordrhein-Westfalen
- ↳ Rheinland-Pfalz
- ↳ Saarland
- ↳ Sachsen
- ↳ Sachsen-Anhalt
- ↳ Schleswig-Holstein
- ↳ Thüringen
- Artikel
- ↳ Allgemein
- ↳ Embryonenschutzgesetz
- Downloads
- ↳ Aktionen
- ↳ Artikel aus Fachzeitschriften
- ↳ Gesundheitsreform 2004
- ↳ Kostenerstattung und Kostenübernahme
- ↳ Medikamente
- ↳ TV-Beiträge
- ↳ Urteile
- ↳ Vitamine
- ↳ Werbung für klein-putz
- Sonstiges
- ↳ Besserwisser-, Plauder- und Witze-Ecke
- ↳ Total anonym
- Buch-, CD-, DVD-, Webseiten-, Kinotipps
- ↳ Bücher
- ↳ CD + CD-ROM
- ↳ DVD / Video / Kino
- ↳ Webseiten
- Rezepte
- ↳ Backen
- ↳ Besondere Ernährung
- ↳ Diät
- ↳ Getränke
- ↳ Kochen
- ↳ Süßspeisen
- Tipps / Hilfe / Beratung
- ↳ Hilfe und Tipps rund um den PC
- ↳ Versicherungen
- ↳ Suche / Biete