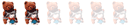siehe http://de.news.yahoo.com/040310/286/3xfhi.html
Eizellen können doch produziert werden
London (AFP) - Der Glaube ist fast hundert Jahre alt: Frauen haben bei ihrer Geburt eine bestimmte Zahl entwicklungsfähiger Eizellen und irgendwann im Leben sind diese einfach aufgebraucht. Doch das stimmt möglicherweise gar nicht - sagen zumindest US-Forscher in der neuen Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift "Nature" unter Berufung auf Experimente an Mäusen. Die weiblichen Säuger produzierten auch als Erwachsene noch neue Eizellen.
"Wenn sich diese Ergebnisse beim Menschen bestätigen, müssen alle Theorien zur Alterung des Reproduktionsvermögens von Frauen überarbeitet werden", betonte Forscher Jonathan Tilly vom Massachusetts General Hospital.
Nach der gängigen Medizinermeinung kommt die Frau mit einer bestimmten Zahl an Eizellen auf die Welt, der sich im Gegensatz zu den Spermien des Mannes nicht erneuert. Diese Reserve wird im Laufe der Jahre aufgebraucht, irgendwann ist der Vorrat an Eizellen leer: Die Menopause beginnt.
Doch dies sei offenbar ein Irrglaube, sagen nun die Wissenschaftler aus Massachusetts. Sie fanden bei Experimenten mit Mäusen heraus, dass die Zahl der Eizellen über einen bestimmten Zeitraum nicht abnahm, obwohl natürlich in dieser Zeit welche heranreiften und mangels Befruchtung wieder abstarben.
"Die einzig mögliche Interpretation ist, dass Eierstöcke auch nach der Geburt in der Lage sind, neue Eizellen zu bilden", schrieb Tilly. Dies sei beispielsweise wichtig für Frauen, deren Eizellen durch eine Chemotherapie bei Krebs geschädigt oder getötet wurden.
Den Mäuse-Experimenten zufolge gibt es bei den weiblichen Säugetieren Zellen, die die Produktion von Eizellen anregen. Um die Sensation perfekt zu machen, fehlt nun nur noch eins: Diese Zellen müssen bei Frauen gefunden werden.
[/b]
mehr dazu auch unter http://de.fc.yahoo.com/s/schwangerschaft.html
Eizellen können doch produziert werden
-
anke-martin
- Rang0
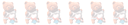
- Beiträge: 113
- Registriert: 26 Jan 2004 13:55
Danke für die Beachtung
In der FAZ hieß es dazu gestern:
Überraschung im Eierstock
Auch verpflanztes Gewebe liefert reife Eizellen
Seit der Geburt des legendären Schafes Dolly im Jahr 1996 sind ungezählte Forscher vom Klonfieber infiziert worden. Die vom Klonen ausgehende Faszination hat zu einem immens gewachsenen Interesse an Stammzellen geführt, an Zellen also, deren Entwicklungsrichtung noch mehr oder weniger offen ist. Man weiß heute, daß Stammzellen auch im ausgewachsenen Organismus noch überraschend weit verbreitet sind, sogar im Gehirn, dessen Nervenzellen lange als prinzipiell unersetzbar galten. Nach Abschluß der Hirnentwicklung ist der Vorrat offenbar doch nicht unwiderruflich aufgebraucht. Neu bewertet werden muß jetzt auch die rund fünfzig Jahre alte Doktrin der Fortpflanzungsbiologie, bei den meisten Säugetieren ende die Produktion von Eizellen in den Eierstöcken schon vor der Geburt. Forscher in Boston haben jedenfalls nachgewiesen, daß in den Ovarien der Maus auch später noch ein Nachschub an Eizellen und Follikeln erfolgt.
Stammzellen in Eierstöcken sind nicht ohne weiteres zu identifizieren. Die Forscher um Jonathan Tilly vom Massachusetts General Hospital und der Harvard-Universität mußten daher für den Nachweis einige Tricks anwenden. Als erstes ermittelten sie die Zahl der Follikel zur Zeit der Geburt - das sind etwa 2500 bis 5000 - und den "Umsatz" in den folgenden Monaten. Dabei zeigte sich, daß die Gesamtzahl nicht annähernd in dem Maße zurückging, wie aufgrund der Lebensdauer der einzelnen Follikel anzunehmen gewesen wäre. Das deutete bereits stark auf den Einfluß von Stammzellen hin. Tatsächlich ließen sich dann Zellen mit entsprechenden Eigenschaften aufspüren. Im Randbereich der Eierstöcke entdeckten die Forscher mit immunologischen Verfahren Populationen von durchschnittlich jeweils 63 solcher Zellen. Als sie derartiges Gewebe mit einem grün fluoreszierenden Protein markierten und in fremde Mäuse-Ovarien verpflanzten, entstanden dort Follikel mit entsprechend fluoreszierenden, offensichtlich aus den Stammzellen hervorgegangenen Eizellen.
Die in der heutigen Ausgabe der Zeitschrift "Nature" (Bd. 428, S. 133 u. 145) vorgestellten Befunde werfen die Frage auf, ob es einen derartigen Nachschub auch beim Menschen gibt. Weil die Stammzellen ebenfalls schwer aufzufinden sein dürften, wäre denkbar, daß sie bislang lediglich übersehen wurden. Sollten sich solche Zellen finden, hätte das erhebliche Auswirkungen auf die Behandlung von Frauen mit Eierstockdefekten. Doch auch ohne explizites Wissen über einen möglichen Stammzell-Pool kann man die Funktion der Eierstöcke immer besser erhalten. Das jüngste Beispiel dafür haben jetzt Reproduktionsmediziner um Kutluk Oktay von der Cornell-Universität in New York geliefert.
Die Forscher haben einer an Brustkrebs leidenden, dreißig Jahre alten Frau vor der Chemotherapie zunächst Eierstockgewebe entnommen und dieses mit dem Ziel eingefroren, es ihr später wieder einzupflanzen. Bei der Krebstherapie können die Eierstöcke derart beeinträchtigt werden, daß es zur Unfruchtbarkeit kommt. Dieses Schicksal wollten die Ärzte der Patientin ersparen. Sechs Jahre nach der erfolgreichen Krebsbehandlung transplantierten sie ihr das Gewebe unter die Bauchhaut. Drei Monate darauf gewann das Transplantat seine ursprünglichen Funktionen zurück. Es bildete Follikel - wenn auch kleinere als üblich - und produzierte Östrogen.
Wie die amerikanischen Forscher in der aktuellen Online-Ausgabe der Zeitschrift "Lancet" berichten, entnahmen sie dem Miniatur-Ovar insgesamt zwanzig reife Eizellen. Acht davon wurden für eine Befruchtung im Reagenzglas ausgewählt. Bei einer verlief die Prozedur wunschgemäß, und es entwickelte sich ein Embryo. Diesen verpflanzte man in die Gebärmutter der Frau. Zwar kam es dann doch zu keiner Schwangerschaft, aber das muß nach Ansicht der Reproduktionsmediziner nicht an der ungewöhnlichen Herkunft der Eizelle liegen, ist doch die Schwangerschaftsrate nach Reagenzglasbefruchtung und Übertragung eines einzigen Embryos auch üblicherweise recht niedrig. Die Gruppe um Oktay ist jedenfalls davon überzeugt, daß die Transplantation eingefrorenen Eierstockgewebes vielen Frauen ihre Fruchtbarkeit zurückbringen kann. Gerade bei Krebspatientinnen ist freilich eine gründliche Prüfung des entnommenen Gewebes unerläßlich, denn es könnte versprengte Tumorzellen enthalten. Dieses Risiko läßt sich bisher schwer abschätzen.
Der Beweis, daß zumindest frische Transplantate von Eierstöcken tatsächlich zu Nachwuchs führen können, ist schon bei Mäusen und Schafen erbracht worden. Nun ist er erstmals auch bei einem Primaten gelungen - beim Rhesusaffen ("Nature", Bd. 428, S. 137). David Lee und andere Forscher von der Oregon Health & Science University in Portland haben mehreren Affen die Eierstöcke entfernt und die Organe anschließend in kleine Stücke zerteilt. Etliche der millimetergroßen Gewebeteile wurden umgehend den jeweiligen Tieren an die verschiedensten Stellen verpflanzt, etwa in den Arm und unter die Bauchhaut. Durch Bluttests ermittelte man dann anhand des Gehalts an Eierstock-Hormonen, wann die Transplantate ihre Funktion aufgenommen hatten. Aus sechs reifen Eizellen, die durch direkte Injektion von Spermien befruchtet worden waren, gingen im Reagenzglas vier Embryonen hervor. Zwei davon, die im sogenannten Morula-Stadium auf eine Affen-Leihmutter übertragen worden waren, führten zur Trächtigkeit und schließlich zur Geburt eines gesunden weiblichen Rhesusäffchens.
REINHARD WANDTNER
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.03.2004, Nr. 60 / Seite 40
Überraschung im Eierstock
Auch verpflanztes Gewebe liefert reife Eizellen
Seit der Geburt des legendären Schafes Dolly im Jahr 1996 sind ungezählte Forscher vom Klonfieber infiziert worden. Die vom Klonen ausgehende Faszination hat zu einem immens gewachsenen Interesse an Stammzellen geführt, an Zellen also, deren Entwicklungsrichtung noch mehr oder weniger offen ist. Man weiß heute, daß Stammzellen auch im ausgewachsenen Organismus noch überraschend weit verbreitet sind, sogar im Gehirn, dessen Nervenzellen lange als prinzipiell unersetzbar galten. Nach Abschluß der Hirnentwicklung ist der Vorrat offenbar doch nicht unwiderruflich aufgebraucht. Neu bewertet werden muß jetzt auch die rund fünfzig Jahre alte Doktrin der Fortpflanzungsbiologie, bei den meisten Säugetieren ende die Produktion von Eizellen in den Eierstöcken schon vor der Geburt. Forscher in Boston haben jedenfalls nachgewiesen, daß in den Ovarien der Maus auch später noch ein Nachschub an Eizellen und Follikeln erfolgt.
Stammzellen in Eierstöcken sind nicht ohne weiteres zu identifizieren. Die Forscher um Jonathan Tilly vom Massachusetts General Hospital und der Harvard-Universität mußten daher für den Nachweis einige Tricks anwenden. Als erstes ermittelten sie die Zahl der Follikel zur Zeit der Geburt - das sind etwa 2500 bis 5000 - und den "Umsatz" in den folgenden Monaten. Dabei zeigte sich, daß die Gesamtzahl nicht annähernd in dem Maße zurückging, wie aufgrund der Lebensdauer der einzelnen Follikel anzunehmen gewesen wäre. Das deutete bereits stark auf den Einfluß von Stammzellen hin. Tatsächlich ließen sich dann Zellen mit entsprechenden Eigenschaften aufspüren. Im Randbereich der Eierstöcke entdeckten die Forscher mit immunologischen Verfahren Populationen von durchschnittlich jeweils 63 solcher Zellen. Als sie derartiges Gewebe mit einem grün fluoreszierenden Protein markierten und in fremde Mäuse-Ovarien verpflanzten, entstanden dort Follikel mit entsprechend fluoreszierenden, offensichtlich aus den Stammzellen hervorgegangenen Eizellen.
Die in der heutigen Ausgabe der Zeitschrift "Nature" (Bd. 428, S. 133 u. 145) vorgestellten Befunde werfen die Frage auf, ob es einen derartigen Nachschub auch beim Menschen gibt. Weil die Stammzellen ebenfalls schwer aufzufinden sein dürften, wäre denkbar, daß sie bislang lediglich übersehen wurden. Sollten sich solche Zellen finden, hätte das erhebliche Auswirkungen auf die Behandlung von Frauen mit Eierstockdefekten. Doch auch ohne explizites Wissen über einen möglichen Stammzell-Pool kann man die Funktion der Eierstöcke immer besser erhalten. Das jüngste Beispiel dafür haben jetzt Reproduktionsmediziner um Kutluk Oktay von der Cornell-Universität in New York geliefert.
Die Forscher haben einer an Brustkrebs leidenden, dreißig Jahre alten Frau vor der Chemotherapie zunächst Eierstockgewebe entnommen und dieses mit dem Ziel eingefroren, es ihr später wieder einzupflanzen. Bei der Krebstherapie können die Eierstöcke derart beeinträchtigt werden, daß es zur Unfruchtbarkeit kommt. Dieses Schicksal wollten die Ärzte der Patientin ersparen. Sechs Jahre nach der erfolgreichen Krebsbehandlung transplantierten sie ihr das Gewebe unter die Bauchhaut. Drei Monate darauf gewann das Transplantat seine ursprünglichen Funktionen zurück. Es bildete Follikel - wenn auch kleinere als üblich - und produzierte Östrogen.
Wie die amerikanischen Forscher in der aktuellen Online-Ausgabe der Zeitschrift "Lancet" berichten, entnahmen sie dem Miniatur-Ovar insgesamt zwanzig reife Eizellen. Acht davon wurden für eine Befruchtung im Reagenzglas ausgewählt. Bei einer verlief die Prozedur wunschgemäß, und es entwickelte sich ein Embryo. Diesen verpflanzte man in die Gebärmutter der Frau. Zwar kam es dann doch zu keiner Schwangerschaft, aber das muß nach Ansicht der Reproduktionsmediziner nicht an der ungewöhnlichen Herkunft der Eizelle liegen, ist doch die Schwangerschaftsrate nach Reagenzglasbefruchtung und Übertragung eines einzigen Embryos auch üblicherweise recht niedrig. Die Gruppe um Oktay ist jedenfalls davon überzeugt, daß die Transplantation eingefrorenen Eierstockgewebes vielen Frauen ihre Fruchtbarkeit zurückbringen kann. Gerade bei Krebspatientinnen ist freilich eine gründliche Prüfung des entnommenen Gewebes unerläßlich, denn es könnte versprengte Tumorzellen enthalten. Dieses Risiko läßt sich bisher schwer abschätzen.
Der Beweis, daß zumindest frische Transplantate von Eierstöcken tatsächlich zu Nachwuchs führen können, ist schon bei Mäusen und Schafen erbracht worden. Nun ist er erstmals auch bei einem Primaten gelungen - beim Rhesusaffen ("Nature", Bd. 428, S. 137). David Lee und andere Forscher von der Oregon Health & Science University in Portland haben mehreren Affen die Eierstöcke entfernt und die Organe anschließend in kleine Stücke zerteilt. Etliche der millimetergroßen Gewebeteile wurden umgehend den jeweiligen Tieren an die verschiedensten Stellen verpflanzt, etwa in den Arm und unter die Bauchhaut. Durch Bluttests ermittelte man dann anhand des Gehalts an Eierstock-Hormonen, wann die Transplantate ihre Funktion aufgenommen hatten. Aus sechs reifen Eizellen, die durch direkte Injektion von Spermien befruchtet worden waren, gingen im Reagenzglas vier Embryonen hervor. Zwei davon, die im sogenannten Morula-Stadium auf eine Affen-Leihmutter übertragen worden waren, führten zur Trächtigkeit und schließlich zur Geburt eines gesunden weiblichen Rhesusäffchens.
REINHARD WANDTNER
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.03.2004, Nr. 60 / Seite 40