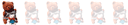Artikel auch im Zusammenhang mit dem Embryonenschutzgesetz
Die IvF hat nicht nur eine erfolgreiche Seite
Experten verweisen auf Mehrlingsgeburten, häufigere Hirnschäden und ethische
Probleme der Reproduktionsmedizin
Der Wunsch nach einem Kind wird in Deutschland zunehmend häufig mit Hilfe
reproduktionsmedizinischer Verfahren erfüllt. Diese gehen mit einer ganzen Reihe
ethischer Fragen einher, über die zur Zeit kein Konsens in der Gesellschaft herrscht.
Schätzungsweise zwei Prozent der Neugeborenen kommen inzwischen in
Deutschland durch künstliche Befruchtung zur Welt. Im vergangenen
Vierteljahrhundert sind weltweit bereits mehr als eine Million Kinder durch
In-vitro-Fertilisation (IvF) gezeugt worden. Verdrängt werde bei dieser Erfolgsbilanz
jedoch die "schreckliche Seite der IvF", sagte der Nürnberger Kinderarzt Professor
Helfried Gröbe bei einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing zu Fragen der
Reproduktionsmedizin.
Mehrlingsgeburten bergen ein erhöhtes Risiko Dazu gehören nach Gröbes Ansicht
die Mehrlingsgeburten, die mit einer erhöhten Sterblichkeit der Kinder und mit einem
erhöhten Risiko für Hirnschäden verbunden sind, und die bei der In-vitro-Fertilisation
überdurchschnittlich häufig sind. Unter den 1998 in Deutschland registrierten
IvF-Kindern gab es außer den rund 4600 Einzelkindern auch mehr als 2300 Zwillinge
und 589 Drillinge, berichtete Gröbe. "Warum werden von den
Reproduktionsmedizinern noch immer so viele Mehrlings-Schwangerschaften
akzeptiert", fragte der Kinderarzt.
Der Kinderwunsch ist nur ein Aspekt der IvF Das sei aber nur ein Aspekt. Tatsächlich
sei die In-vitro Fertilisation nicht nur eine Methode zur Erfüllung des unerfüllten
Kinderwunsches, sondern auch eine "Einstiegstechnik" für eine ganze Reihe
weiterer Entwicklungen in der Medizin gewesen, erinnerte der Münchner Gynäkologe
Professor Hermann Hepp. Die Verfeinerung der vorgeburtlichen Diagnostik, die
Forschung an embryonalen Stammzellen und in jüngster Zeit die
Präimplantationsdiagnostik (PID) aber auch Themen wie "Schwangerschaft auf
Probe" seien eng mit der In-vitro-Fertilisation verknüpft.
Mit der aktuellen Diskussion um die Zulässigkeit der PID würden deshalb auch keine
grundsätzlich neuen Probleme aufgeworfen, meinte Hepp. Die Warnung vor einem
"Dammbruch", wenn die PID in Deutschland zugelassen würde, komme daher zu
spät. Die Weichen seien schon früher gestellt worden. "Tatsächlich kommen jetzt die
ganzen ungelösten Probleme mit dem Embryonenschutzgesetz auf den Tisch",
ergänzte die Tübinger Medizinethikerin Dr. Hille Haker.
Bei den meisten ethischen Problemen der Reproduktionsmedizin gebe es keinen
gesellschaftlichen Konsens, erklärte denn auch Hepp. Schon die Frage, ob
ungewollte Kinderlosigkeit eine Krankheit ist, sei umstritten. Viele seien bereit, dies
unter der Überschrift "Luxusmedizin" einzuordnen. Auf der anderen Seite würden
Themen wie der unselektierte Foetizid bei Mehrlings-Schwangerschaften in der
öffentlichen Wahrnehmung ausgeblendet. Auch zur Frage, wann Leben beginnt oder
welchen Status embryonales Leben habe, gebe es keinen Konsens, "weder bei uns
noch anderswo", sagte Hepp.
Dem hielt allerdings die Kieler Juristin Professor Monika Frommel entgegen, viele
Fragen aus dem Bereich der Reproduktionsmedizin seien durch die gesetzlichen
Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch und andere Bestimmungen längst
entschieden.
Zudem bestehe Einigkeit, daß verbrauchende Embryonenforschung oder eine
positive Eugenik verboten sein soll, sagte Frommel. Im übrigen habe heute das
Entscheidungsrecht der Frau im Sinne eines "bioethischen Selbstbestimmungsrechts"
in den meisten Fragen der Reproduktionsmedizin den Vorrang, betonte die Kieler
Juristin.
Dem Berliner Gynäkologen und früheren Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für
Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Professor Heribert Kentenich,
ist das noch nicht genug. Er sprach sich für eine weitere Stärkung der
Patientenautonomie sowie für die Zulassung der heterologen Insemination aus.
Gerade in der Reproduktionsmedizin gehe es darum, den Patientenauftrag ernst zu
nehmen. Das beinhalte aber auch eine umfassende Information und Beratung der
betroffenen Paare.
Um die Rate der Mehrlings-Schwangerschaften zu senken, sprach sich Kentenich
zugleich für ein "abgestuftes Konzept des Lebensschutzes" aus. Wie in den
skandinavischen Ländern sollte es auch bei uns möglich sein, bis zu sechs Eizellen
zu befruchten, dann aber nur ein oder zwei der besten zu implantieren und den Rest
zu verwerfen.
Parlamentarier stehen vor schwierigen Entscheidungen Das wiederum wirft aber die
Frage auf, wie künftig mit überzähligen Embryonen umgegangen werden soll. Für die
Bundestagsabgeordneten werde dies eine der schwierigsten Entscheidungen sein,
meinte Dr. Volker Grigutsch vom Bundesgesundheitsministerium mit Blick auf die
bevorstehenden gesetzlichen Regelungen zur PID und zur Forschung an
embryonalen Stammzellen. Die Bundesregierung will vor einer Gesetzesinitiative ein
Votum des Nationalen Ethikrats abwarten.
Liebe Anke,
muß ich jetzt selbst mal durchstöbern, habe so einiges gefunden über google, aber auch unter http://www.wunschkinder.net. Ich kann Dir leider jetzt nicht mehr schreiben, wo? Ich suche momentan immer noch einiges zusammen, werde ich heute Abend - sofern ich dieses schaffe - mal alles nachschauen.
Liebe Grüße
Silvia
muß ich jetzt selbst mal durchstöbern, habe so einiges gefunden über google, aber auch unter http://www.wunschkinder.net. Ich kann Dir leider jetzt nicht mehr schreiben, wo? Ich suche momentan immer noch einiges zusammen, werde ich heute Abend - sofern ich dieses schaffe - mal alles nachschauen.
Liebe Grüße
Silvia