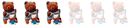taz Nr. 7253 vom 9.1.2004, Seite 19
Harte Einschnitte für Repromediziner
Italien hat jetzt das strengste Fortpflanzungsmedizingesetz in Europa: Ei-
und Samenspenden sind verboten. Auch die Embryonenselektion im Reagenzglas
ist untersagt. Die In-vitro-Befruchtung ist nur noch in Ausnahmefällen
erlaubt
Die katholische Kirche in Italien jubelt. Denn sie hat dem Gesetz 1514, das
die künstliche Befruchtung regelt, ihren Stempel aufgedrückt. Nein zur
Befruchtung im Reagenzglas heißt es im Artikel 4. Nein zur
Präimplantationsdiagnostik sagt Artikel 6. Und auch die Ei- und Samenspende
ist verboten. Auf künstlich befruchteten Nachwuchs können künftig nur
verheiratete Paare hoffen und solche, die in eheähnlichen Gemeinschaften
leben. Keine Chance dagegen haben homosexuelle Paare und Singles.
Nachdem die Abgeordnetenkammer der Regierungsvorlage im Juni zugestimmt
hatte, votierte auch kurz vor Jahresende der Senat für das strengste
Fortpflanzungsmedizingesetz in Europa. Auch Mitglieder der
Mitte-links-Partei Margherita schlossen sich der
Mitte-rechts-Regierungskoalition, dem Polo, an.
Die Gegner des Gesetzes zur künstlichen Befruchtung - unter ihnen die
Linksdemokraten - sind empört. Staatssekretärin Margherita Boniver spricht
in Anspielung auf die Kopftuchdebatte von einem "Burka"-Gesetz, das die
Unabhängigkeit der Frau untergrabe. Und die Ärzteschaft verweist auf
dieniedrigen Erfolgschancen und die hohen Gesundheitsrisiken, die die neue
Befruchtungspraxis mit sich bringen werde.
Denn eine Reagenzglasbefruchtung (In-vitro-Fertilisation) darf künftig nur
noch dann durchgeführt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten versagen. Das
heißt, die Eizelle soll nicht im Reagenzglas, sondern erst einmal direkt im
Mutterleib befruchtet werden. Dies erhöht jedoch das Risiko einer
Mehrlingsschwangerschaft - und senkt die Erfolgschancen: von etwa 30 Prozent
bei einer Reagenzglasbefruchtung auf knapp 15 Prozent.
Wenn eine In-vitro-Befruchtung in Ausnahmefällen stattfindet, dürfen künftig
nur noch maximal drei Eizellen befruchtet werden. Das Problem dabei: Viele
der auf diese Weise erzeugten Embryonen sind nicht überlebensfähig. "Das ist
so, als wolle man die Brücke von Messina mit nicht mehr als 400.000 Tonnen
Zement bauen", sagt die Europaparlamentarierin Emma Bonino.
Um diesen Unsicherheitsfaktor einzudämmen, wurden bisher möglichst viele
Eizellen in vitro befruchtet. Nach zwei oder drei Tagen wurden die beiden
fittesten Kandidaten ausgewählt und in die Gebärmutter eingepflanzt. Die
potenziellen Geschwisterchen, die nicht zum Zug gekommen waren, wurden
eingefroren - für den Fall, dass der erste Versuch scheiterte. Die Folge: In
den rund 300 Fruchtbarkeitskliniken Italiens liegen über 20.000 eingefrorene
Embryonen. Dies errechnete 2000 eine vom Gesundheitsministerium eingesetzte
Kommission.
In Zukunft ist eine solche Dauerkonservierung nicht mehr erlaubt: Die drei
in vitro befruchteten Embryonen müssen allesamt in den Uterus eingesetzt
werden. Ebenso ist es verboten, Embryonen zu vernichten oder für
wissenschaftliche Zwecke zu verwenden. Dabei sind italienische
Wissenschaftler auf dem besten Weg, das ethische Dilemma eingefrorener
Embryonen zu lösen. Ein vom Gesundheitsministerium unterstütztes
Forscherteam unter der Leitung des Bologneser Fortpflanzungsmediziners Carlo
Flamigni versucht, unbefruchtete Eizellen einzufrieren - um sie für weitere
Befruchtungsversuche bereitzustellen.
Die Schwierigkeit dieses Verfahrens: Eizellen enthalten viel Wasser und
können deshalb bei tiefen Temperaturen leicht beschädigt werden. Doch die
Forscher sind zuversichtlich, die Technik in den nächsten Jahren zu
perfektionieren - und die Gefahr von Fehlbildungen zu bannen. Doch nun steht
das Projekt auf der Kippe. Denn das neue Befruchtungsgesetz verbietet auch
die Präimplantationsdiagnostik (PID) - also die Untersuchung der Embryonen
auf genetische Krankheiten. Von dem Verbot betroffen ist nicht nur die
Forschung, auch Eltern, die verhindern wollen, dass an ihren Nachwuchs ein
Erbleiden weitergegeben wird, dürfen die PID nicht anwenden. "BETTINA
GARTNER
taz Nr. 7253 vom 9.1.2004, Seite 19, 131 Zeilen (TAZ-Bericht), BETTINA
GARTNER,
Neues Repro-Gesetz in Italien !!!!!!!!!!!!!
Neues Repro-Gesetz in Italien !!!!!!!!!!!!!
Falls es jemand interessiert, habe dies gerade gefunden 
 :
:
Liebe Grüße,
Floppy mit Nick & Ben (*10.12.2003)
mit Nick & Ben (*10.12.2003)

Floppy

Danke für die Beachtung
-
anke-martin
- Rang0
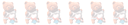
- Beiträge: 113
- Registriert: 26 Jan 2004 13:55
neues Italienisches Repro-Gesetz hier im Forum
ja, stimmt, Danke aber dazu gibt es schon ein paar Menge Beiträge hier im Forum:
Schau mal hier nach:
http://www.klein-putz.de/forum/viewtopic.php?t=15267
oder bei wunschkinder.net
http://www.wunschkinder.net/news/wmview.php?ArtID=340
Schau mal hier nach:
http://www.klein-putz.de/forum/viewtopic.php?t=15267
oder bei wunschkinder.net
http://www.wunschkinder.net/news/wmview.php?ArtID=340