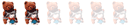Mobber leben gefährlich !
Copyright A. Dutschmann 2004. Download und Kopien nur komplett!
www.drdutschmann.de
Das Thema Mobbing war eigentlich schon immer aktuell. Erst in letzter Zeit erlangt es jedoch an Publizität. Wegen des großen menschlichen und wirtschaftlichen Schadens, der dadurch angerichtet wird, ist es erfreulich, dass sich immer mehr Menschen trauen, über einschlägige Probleme zu sprechen.
Die vorliegende Schrift hat zwei Ziele:
1. Die Erfahrung zeigt, dass manche Täter sich nicht bewusst sind, was sie mit ihrem Verhalten anrichten und in welche Gefahr sie sich selbst begeben. Häufig würden sie ihr Vorgehen nicht einmal als Mobbing bezeichnen. Das Ziel der Schrift wäre erreicht, wenn der eine oder andere in diesem Sinne nachdenklich gestimmt werden könnte.
2. Opfern werden Hilfen geboten, die Situation einzuschätzen und Vorschläge für strategische Gegenmaßnahmen gemacht
Was ist Mobbing ?
Im Englischen bedeutet "mob" zusammengerotteter Pöbelhaufen, Gesindel, Bande, Sipp-schaft.
Als Mobbing bezeichnet man neuerdings alle Verhaltensweisen, die geeignet sind, andere Menschen zu schikanieren, sie auszugrenzen,
als Sündenbock hinzustellen, kaltzustellen etc.
Von Mobbing kann dann gesprochen werden, wenn entsprechende Handlungen über einen längeren Zeitraum erfolgen und/oder wenn sie gezielt zur Schädigung des Opfers eingesetzt und negative Auswirkungen in Kauf genommen werden.
Wer wird Opfer ?
Grundsätzlich hat jeder die Chance, Opfer zu werden.
Dass Mobbingopfer "böse" und "minderwertig" sind, ist ein Mythos, den Täter gern verbreiten. Opfer sind im Gegenteil nicht selten Personen, die durch besondere Leistungen, Prominenz, Kreativität etc. auffallen. Eine erhöhte Chance, Opfer zu werden, und das kann nicht oft genug betont werden, haben die Täter.
Mobber sind Täter !
Nach den vorliegende Zahlen muss davon ausgegangen werden, dass ein nicht geringer Teil von Mobbingopfern ernsthaft krank werden. Mobbing beeinträchtigt das Wohlbefinden, führt zu Arbeitsausfällen, Störungen des Betriebsfriedens und zur Behinderung von Produktionsabläufen. Der Ruf der Firma oder Behörde wird geschädigt. Es wird somit menschlicher und wirtschaftlicher Schaden angerichtet.
Mobber leben gefährlich !
Dafür gibt es drei Gründe:
1. Mögliche rechtliche Folgen
Grundsätzlich besteht für den oder die Täter wegen der angerichteten Schäden die Gefahr, sich in eine juristisch problematische Situation zu begeben. Es ist im Einzelfall natürlich nicht immer möglich, justitiable Vergehen nachzuweisen. In der Vergangenheit galt Mobbing zudem als Kavaliersdelikt. Eine juristische Würdigung fand selten statt. Inzwischen ist man sensibler geworden. Durch das StGB werden eine Reihe von Handlungen erfasst, die im Zusammenhang mit Mobbing vorkommen können, z.B. Beleidigung (§185), Üble Nachrede (§186) Verleumdung (§187) etc.
Vorgesetzte, die Mobbinghandlungen dulden, ihnen gar Vorschub leisten, sind prinzipiell mitschuldig.
2. Gefahr, selbst ausgegrenzt oder zum Opfer zu werden
Ab einem bestimmten Punkt werden Mobber für Kollegen, Vorgesetzten oder den Betrieb ein Problem. Die Gefahr, dass sie dann selber zum Opfer werden, ist groß. Viele Mobber werden selbst missbraucht oder sind Opfer von Gruppendynamiken. Dadurch geraten sie leicht in Verstrickungen, müssen u.U. das ausbaden, was andere durch gezieltes Intrigieren eingefädelt haben.
3. Gegenmaßnahmen der Opfer
Es muss damit gerechnet werden, dass Opfer Gegenmaßnahmen einleiten. Starke und kreative Persönlichkeiten gehen dabei in der Regel als Gewinner aus dem Kampf hervor. Vergeltungsmaßnahmen sind wahrscheinlich. Dabei besteht natürlich die Gefahr, dass das Opfer selber zum Täter wird.
Nicht übersensibel reagieren !
Beim zunehmenden Interesse für das Thema besteht wie immer im Zusammenhang mit aktuellen und viel beachteten Themen die Gefahr der Übertreibung. Auch das Gefühl, Mobbingopfer zu sein, kann zu Überempfindlichkeiten führen. Man reagiert dann auf Kritiken oder kleine Unachtsamkeiten, wie emotionale Ausrutscher, überzogen, und setzt damit u.U. einen Kreisprozess in Gang.
Es muss die Möglichkeit bestehen -sachlich, fair und konstruktiv- Kritik zu üben, ohne dass dies als Mobbing überinterpretiert wird.. Manche unangenehme Entscheidung wird aus Sachgründen her notwendig sein. Dies den Mitarbeitern plausibel zu machen und in fairer Weise umzusetzen, ist die Aufgabe des verantwortungsvollen und führungskompetenten Vorgesetzten.
Die Täter
Gemobbt wird aus verschiedenen Motiven heraus. Dies ist wichtig zu wissen, wenn man als Opfer Gegenmaßnahmen einleiten will oder als Vorgesetzter und Kollege Mobbinghandlungen möglichst schon im Frühstadium unterbinden möchte. Ganz grob können in diesem Sinne Täter in eine Typologie eingeteilt werden:
1. Machtmobber
Es handelt sich häufig um Vorgesetzte oder um Personen, die auf Kosten des Opfers einen Machtgewinn erzielen möchten.
Methoden:
Ausbooten, Zuweisung von unterfordernden Tätigkeiten, ständiges unsachliches Kritisieren, Abwerten der Leistungen des Opfers, Nicht-zur-Kenntnis- Nehmen der Leistungen etc.
Mitunter werden gruppendynamische Prozesse ausgenutzt: Opfer werden gezielt versetzt, z.B. in der Hoffnung, dass sie von den neuen Kollegen "fertiggemacht" werden. Ihnen wird eine Sündenbockfunktion zugewiesen. Es werden Tribunale inszeniert, auf denen (vom "Mob") auf dem Opfer herumgehackt wird.
Machtmobber gehen häufig geschickt und subtil vor. Sie verfügen über entsprechendes Hin-tergrundwissen, Connections und oft über eine gewisse Skrupellosigkeit.
2. Neidmobber
Das Opfer wird attackiert, weil es Eigenschaften hat, die man selber gerne hätte: Titel, Erfolge, Prominenz, Popularität, bessere Fachkenntnisse etc.
Methoden:
S.o.!
Häufig kommt es zudem zur Abwertung der Person des Opfers, Rufmord.
3. Angstmobber
Das Opfer erinnert die Täter an eigene Unzulänglichkeiten, bedroht ihr Selbstwertgefühl. Sie haben Angst vor Veränderungen. Von den bisherigen Gewohnheiten oder von ihren Erwartungen abweichende Verhaltensweisen werden abgewertet, ohne Hinterfragen kritisiert.
Angstmobber sind häufig Opfer von Machtmobbern, die bewusst Ängste schüren. Durch Rufmord und gezieltes Intrigieren werden sie gegen Sündenböcke mobilisiert.
Methoden:
S. unter 1 und 2. Da Angstmobber häufig stark emotional beeinträchtigt sind, sehen sie die Zusammenhänge sehr einseitig. Das Opfer wird, gleichgültig, wie es sich verhält, negativ gesehen. Oft werden ihm minderwertige Persönlichkeitseigenarten unterstellt. Aus Angst, in einer sachlichen Diskussion den Kürzeren zu ziehen, was wiederum das Selbstwertgefühl beschädigen könnte, werden klärende Gespräche vermieden. ("Darüber will ich jetzt nicht mit Ihnen reden!", "Es hat ja keinen Zweck, mit Ihnen zu diskutieren!".)
Angstmobber fühlen sich häufig selbst als Opfer, unverstanden, alleine gelassen. Sie erleben ihr Verhalten nicht selten als Reaktion auf vermeintliches Fehlverhalten des Opfers.
4. Lustmobber
Diesen macht es einfach Spaß, andere zu schikanieren, zu intrigieren und für Aufregung zu sorgen. Häufig sind sie auch Machtmobber. Aus psychiatrischer Sicht zeigen sie häufig eine Affinität zu gefühlskalten Psychopathen.
Methoden:
Die Motive anderer Mobbertypen, besonders Angstmobber, werden geschickt ausgenutzt. Typisch ist das Ausstreuen vager Gerüchte und Unterstellungen. Auch sie neigen zur Inszenierung von Tribunalen, auf denen das Opfer von den Kollegen fertiggemacht werden soll.
5. Hühnerhofmobber
Gruppen neigen zur Aufstellung von Hackordnungen. Das ist bei Hühnern nicht anders als beim Menschen.
Methoden:
Direktes Attackieren, Beschimpfen, Erniedrigen. Es wird kein Hehl daraus gemacht, dass man andere schikaniert.
6. Herdenmobber
Als soziales Wesen möchte der Mensch zu einer Gruppe gehören, dort anerkannt und geliebt werden. In der Gruppe fühlt man sich geborgen und stark. Herdenmobber sind für sich alleine häufig sehr unsicher, ängstlich und vermeiden aus diesem Grunde die Diskussion mit dem Opfer.
Um dazuzugehören, schließt man sich mehr oder weniger unbewußt einer Gruppennorm an. Das gilt auch für die Auswahl von Mobbingopfern. Durch Gruppendruck kann es zu für Außenstehende verblüffende Wahrnehmungsverzerrungen kommen, durch die das Opfer in einem schlechten Licht gesehen wird.
Herdenmobber sind eher wenig eigenständig und selbstkritisch. Sie sind überwiegend Opfer der Gruppendynamik, von Führern und Verführern. Durch Versetzungen und Veränderungen im Gruppensystem können sie friedfertig und kooperativ werden.
7. Der "edle" Mobber
Dieser fühlt sich "edel", "hilfreich" und "gut". ER bzw. SIE setzt sich für die gute Seite ein, während andere -so seine Auffassung- gegen das Gute verstoßen. Häufig handelt es sich um Helfer, die mangelnde Sachkunde mit erhöhtem Engagement zu kompensieren versuchen. Durch die Spaltung in Gut und Böse kann man subjektiv seinen eigenen Wert erhöhen.
Methoden:
Die eigene Person oder Gruppe wird aufgewertet, die scheinbaren oder tatsächlichen Leistungen werden betont. Gleichzeitig wird auf die angeblichen Unzulänglichkeiten des oder der "Bösen" hingewiesen. Es besteht eine Tendenz, sich über diese bei Vorgesetzten zu beschweren. Da sie ja "gut" sind, nehmen sie sich das Recht heraus, ggf. alle andere, die gegen ihre Überzeugung verstoßen, andere Auffassungen oder Angehensweisen haben, abzuwerten und zu attackieren. Die Handlungsweisen des Opfers werden nicht hinterfragt, sondern negativ kritisiert. Andere Meinungen werden als Feindseligkeit betrachtet und entsprechend geahndet
(
"I´m a pacifist - I´ll kill everyone who´s not!").
Diese Typologie ist nicht vollständig. Möglicherweise wird man in seinem Arbeitsbereich auch andere Formen finden.
Häufig kann man einen Täter auch verschiedenen Typen gleichzeitig zuordnen. In diesem Falle empfiehlt es sich, Vermutungen über das Ausmaß verschiedener Anteile anzustellen.
Wie erkennt man Mobber?
Zum großen Teil geht dies bereits aus der Typologie hervor.
Bezüglich äußeren Verhaltens kann man unabhängig vom Typ in vielen Fällen folgende Ver-haltensweisen feststellen:
1. Der
"freundliche" Mobber
Chronische Mobber sind nicht selten charmant und freundlich. Man traut ihnen Gemeinheiten nicht zu.
2. Der "korrekte" Mobber
Das Verhalten wirkt formal, durchaus höflich.
3. Der
Emotionstechniker
Viele Mobber spielen geschickt auf der Klaviatur der Emotionen. Dabei wird z.B. der Eindruck erweckt, das Opfer sei böse, der Täter und andere sind gut (Spaltung). In vielen Fällen ist der Verdacht, dass diejenigen, die vermehrt und immer wieder zur Anwendung solcher Techniken neigen, möglicherweise eine Persönlichkeitsstörung aufweisen (Boredlinesyndrom) nicht von der Hand zu weisen
Beispiele:
* Antipathie signalisieren
* Dem Opfer glauben machen, es sei überall unbeliebt.
* Einem Dritten gegenüber tiefes Vertrauen signalisieren und gleichzeitig Misstrauen dem Opfer gegenüber betonen.
* Gut inszenierte Emotionsausbrüche - Weinen, Schreien, Rausrennen, etc.
* Theatralisch emotional gefärbte Bewertungen, z.B. bei kleinen tatsächlichen oder vermeintlichen Fehlern. Umgekehrt werden -in der Absicht, das Opfer zu treffen- auch mittelmäßige Leistungen anderer überschwänglich gelobt.
etc.
4. Der
Verrücktmacher
Hier gibt es zwei Ansätze:
a) Man kann machen, was man will, es ist auf jeden Fall falsch. Da der Täter das Opfer ja schikanieren möchte, ist er an dessen objektiv guten Leistungen nicht interessiert - eher im Gegenteil.
b) Der Täter ist unberechenbar. Heute schikaniert er das Opfer, inszeniert dramatische Emotionsaus- brüche. Das Opfer ist geknickt. Am nächsten Tag ist er freundlich, scheinbar verständnisvoll. Das Opfer atmet auf und schreibt möglicherweise seine Probleme mit dem Täter der eigenen Überempfindlichkeit zu.
5. Der
offene Mobber
Dieser macht keinen Hehl aus seinen Absichten. Mitunter kündigen sie sich sogar als Täter an: "Ich bin hier, um den K. abzuschießen !".
Sie fühlen sich häufig sicher, weil sie sich unterstützt und im Recht fühlen. Es handelt sich häufig um Hühnerhof- und Herdenmobber. Sie werden aber auch gern von intelligenteren oder geschickteren Mobbern (Machtmobbern, Lustmobbern) vorgeschoben. Da offene Aggressoren am ehesten in die Schusslinie geraten, können sich die Drahtzieher im Notfall rechtzeitig zurückziehen.
6. Der
"betroffene" Mobber
Dieser glaubt wirklich daran, dass das Opfer böse ist. Erkennbar sind sie daran, dass sie bereits bei der ersten Begegnung Ängste und Vorurteile dem Opfer gegenüber zeigen. Sie sind über die angeblich schlechten Eigenschaften des Opfers vorinformiert ("Nimm dich in acht vor...., "Du wirst schon noch sehen....!"). Auch bei gutem Willen, sich sachlich und fair zu verhalten, werden sie sich über den Gruppendruck und selektive Wahrnehmungen bald der Gruppennorm anpassen. Dieser Prozess wird wiederum als "Beweis" für die Bösartigkeit des Opfers herangezogen.
Was tun?
Unternehmensphilosophie
Grundsätzlich besteht für Vorgesetzte die Pflicht, für die Einhaltung des Betriebsfriedens zu sorgen. Das muss so geschehen, dass die Regeln der Fairness und des Respektes vor dem Individuum gewahrt werden.
Dies kann aber nur in Betrieben mit entsprechender Unternehmensphilosophie- und Moral im ausreichendem Maße durchgesetzt werden. Gilt die Regel "Hier mobbt der Chef!", wird es Probleme geben -langfristig auch für den Chef und für das Wohl des Betriebes. Es ist im Sinne der Effektivität und Produktivität, wenn Mobben ausdrücklich geächtet wird und entsprechende Aktivitäten sorgfältig beobachtet und ggf. geahndet werden. Mobber müssen wissen, dass sie ihr Tun nicht mehr ohne Gefahr für sich selbst fortsetzen können.
Direktionen, Betriebsleitungen, vorgesetzte Behörden und Institutionen, Personalvertretungen und nicht zuletzt jeder einzelne Mitarbeiter sind hier in die Verantwortung genommen.
Grundregeln für Opfer
1. Kritische Selbstbeurteilung aber kein Selbstzweifel
Jeder kann, abhängig von den strukturellen und sozialpsychologischen Bedingungen eines Betriebes zum Mobbingopfer werden. Das ist an sich kein Grund, an sich zu zweifeln. Das sollte nicht daran hindern, sich selbstkritisch zu hinterfragen. Konstruktive und sachliche Kritik sollte ernst genommen werden.
Solche vermeiden Mobber aber meistens: Sie neigen zu vagen, undifferenzierten Vorwürfen, pauschalen Angriffen gegen die Persönlichkeit und unreflektierten Kritiken, häufig emotional, beleidigend vorgebracht oder hinter dem Rücken getuschelt.
Solche Attacken sind irrelevant und sagen mehr über den Täter aus als über das Opfer.
2. Cool bleiben, Ruhe bewahren
In der Regel ist es nicht zu empfehlen, im aufgeregten Zustand Gegenmaßnahmen zu unternehmen. Dann verhält man sich so, wie die Täter es erwarten, man wird manipulierbar und verliert die Übersicht. Ggf. ist eine längere Denkpause, durchaus über Monate angezeigt, wenn man merkt, dass Emotionen das Denkvermögen beeinträchtigen.
Empfohlen wird unser Trainingsprogramm In Ruhe und Gelassenheit.
In Ruhe und Gelassenheit
Ein Trainingsprogramm
Erregung und unangenehme Gefühle können unsere Leistungsfähigkeit und Lebensqualität mindern.
Das Programm bietet auf engen Raum viele Tipps und Techniken für ein effektives Emotionsmanagement.
Mehr Infos
Infos schließen
3. Keine Rundumschläge
Wenn man nicht über ein ausgesprochenes Selbstbewusstsein verfügt, ist man doch häufig betroffen, wenn man sich als Opfer von Mobbingattacken sieht. Man neigt dann in seinem Frust leicht dazu, alle Kollegen, alle Vorgesetzte und den ganzen Betrieb über einen Kamm zu scheren.
Das ist aber in der Regel eine falsche Einschätzung. Rundumschläge treffen viele Unschuldige und vielleicht sogar Freunde. Schon hat man eine Reihe neuer Gegner. Das Ziel der Mobber ist erreicht.
Auch deshalb: Denkpausen einlegen, genau beobachten, differenziert wahrnehmen.
4. Situation analysieren
In größeren Betrieben werden sich über diese differenzierte Beobachtung schnell interessante Ergebnisse zeigen. Die Mobber haben z.B. selber Feinde, vielleicht, weil sie auch schon andere gemobbt haben. Mobber fühlen sich im engen Kreise ihrer Mitmobber oft sehr sicher. Sie schätzen die Situation deshalb häufig unkritisch ein, denken nicht nach, während das Opfer sich weiterentwickeln und in Ruhe Gegenmaßnahmen planen kann.
5. Mit eigenen Fehleinschätzungen rechnen
Eigene Fehleinschätzungen der Zusammenhänge können sich akut aus emotionaler Beeinträchtigung ergeben.
Aber auch sonst kann man sich täuschen. Nicht jeden erkennt man sofort als Feind oder Freund. Man weiß ggf. nicht, wer mit wem Beziehungen pflegt. Auch viele Hintergrundinformationen sind nicht bekannt.
Außerdem können sich Einstellungen, Beziehungen und Verhaltensmuster ändern. Es kann sein, dass sich ein ehemaliger Verbündeter unter dem Einfluss von Gruppendruck abwendet ("Der Feind schläft nicht"). Umgekehrt kann es sein, dass jemand auf die Aktivitäten des Opfers aufmerksam wird und sich als Verbündeter anbietet, möglicherweise weil er selber Opfer ist. Mancher Täter (z.B. "Herdentäter") merkt, wie er sich hat mitreißen lassen und findet die Kraft, sich von der Masse zu trennen.
6. Hilfe und Verbündete suchen
Die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit für das Problem lässt die Chance steigen, dass man verständnisvolle Zuhörer und Helfer findet. Freunde, Kollegen, andere Opfer, Vorgesetzte und Personalvertreter können im Rahmen des Betriebes hilfreich sein. In der Regel wird man schnell merken, dass die Mobber selbst Feinde haben (sie bemerken das in ihrer Verblendung häufig nicht), mit denen man sich verbünden kann.
Außerhalb des Betriebes bieten sich professionelle Helfer an: Supervisoren, Coaches, Therapeuten, Rechtsanwälte.
7. Kompetenz erwerben, strategisch vorgehen
Krisen sind gute Motive, sich weiterzuentwickeln. Das ist die Chance des Opfers und der Nachteil der Täter, die dazu in der Regel keine Veranlassung sehen.
Das Strategische KonfliktManagement hilft, gezielt und souverän der Probleme Herr zu werden.